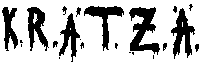Lernen in Freiheit
Entwurf eines freiheitlich-demokratischen Bildungssystems
3. Auflage – überarbeitete Version
Inhalt
- Grundüberlegung
- Bestandsaufnahme
- Lernen ohne Druck und Zwang
- Grundlagen eines freiheitlich-demokratischen Bildungssystems
- Konkrete Bildungsmöglichkeiten
- Recht auf selbstbestimmte Bildung durchsetzen
- Organisatorische Fragen
- Der Übergang zur Freiheit
- Die wichtigsten Änderungen gegenüber der 1. Ausgabe
- weiterführende Texte
Grundüberlegung
Eine freiheitlich-demokratische, also eine auf den Prinzipien von Selbstbestimmung und Mitbestimmung aufbauende Gesellschaft muß logischerweise auch ihr Bildungssystem auf diese Grundlage stellen. Kinder und Jugendliche müssen folglich im Rahmen des organisatorisch Möglichen selbstbestimmt entscheiden dürfen, was sie lernen und wo, wann, wie und von wem sie es lernen.
Das derzeitige Schulsystem wird diesem freiheitlich-demokratischen Anspruch nicht gerecht.
Bestandsaufnahme
Dem jetzigen Schulsystem liegt ein Menschenbild zugrunde, das davon ausgeht, daß Kinder und Jugendliche noch keine vollwertigen Menschen sind, daß sie unfähig seien, über ihr Leben selbst zu bestimmen und deshalb durch Zwang zu ihrem (angeblichen) Glück gebracht werden müßten. Es wird davon ausgegangen, daß junge Menschen ohne Zwang nicht – oder nur Unnützes – lernen würden und sich somit für immer ihre Zukunft verbauen oder gar zu asozialen oder kriminellen Wesen verkommen würden.
Entsprechend ist das jetzige Schulsystem von Fremdbestimmung und Bevormundung geprägt. Kinder und Jugendliche müssen zur Schule gehen, egal ob sie wollen oder nicht – es besteht Schulpflicht. Sie müssen das lernen, was andere für wichtig und richtig halten, unabhängig davon, ob sie sich dafür interessieren. Und tatsächlich interessiert sich ein Großteil der Schüler nicht für den ihnen vorgesetzten Unterricht. Das liegt wohl auch daran, daß die Inhalte mit ihrem jeweils aktuellen Leben wenig zu tun haben. Darüber hinaus müssen Schüler stillsitzen und den Mund halten, es sei denn, sie werden zum Reden aufgefordert. Und sie müssen von Menschen lernen, die sie vielleicht nicht mögen. Lernen heißt in deutschen Schulen meist nicht Begreifen und Erfahren, sondern zum großen Teil stur Auswendiglernen.
Schüler sind einer ständigen Bewertung ausgesetzt. Diese auf Zensuren basierende Bewertung entscheidet über die weiteren Bildungsmöglichkeiten und späteren Chancen der Schüler auf dem Arbeitsmarkt. Zensuren haben eine Auslesefunktion. „Gute Schüler“ gibt es im Zensurensystem nur, wenn es auch "schlechte" gibt. Wenn alle eine „1“ haben, ist sie nichts wert. Die Leistungskontrolle, Klassenarbeit oder Klausur war dann „zu leicht“. Der Lehrer muß also darauf achten, daß sich eine „Normalverteilung“ der Zensuren (einige gute, viele durchschnittliche, einige schlechte) einstellt, weil eine Selektion sonst nicht möglich ist.
Zensuren sind also für das gesamte spätere Leben der Schüler von Bedeutung. Gleichzeitig sind sie jedoch weit davon entfernt, objektiv zu sein. Da die Schüler auf möglichst gute Zensuren angewiesen sind, kann der Lehrer die Zensurengebung benutzen, um ihm unliebsame Schüler zu bestrafen und zur Unterordnung zu bewegen. Zensuren dienen also der Machterhaltung des Lehrers. Zensuren erzeugen Druck und machen vielen Schülern Angst. „Schlechte“ Schüler fühlen sich oft minderwertig. Zensuren und andere nicht vom Schüler angeforderte Bewertungen stehen einem selbstbestimmten Lernen im Weg.
Daß Schüler dem Lehrer ständig Sachen erzählen sollen, die dieser längst weiß, gehört auch zur absurden Schulrealität. Unterricht wird oftmals zu einer Art Profilierungsshow, bei der jeder Schüler zeigen soll, was er kann und daß er besser ist als alle anderen. Gegenseitige Hilfe unter Schülern ist im Unterricht daher vielfach unerwünscht, wenn nicht sogar verboten.
Das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern ist von einem großen Machtgefälle geprägt. Lehrer dürfen Befehle erteilen, und die Schüler müssen gehorchen. Möglichkeiten, sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren, gibt es kaum. Mangels schulinterner Gewaltenteilung – Beschluß, Durchführung und Kontrolle liegen in einer Hand – bekommt der Lehrer (fast) immer recht. Eine auf Demokratie basierende Gestaltung des Zusammenlebens an der Schule, bei der jeder Schüler und jeder Lehrer eine Stimme hätte, findet naheliegenderweise auch nicht statt.
Wer nicht bereit ist, sich den undemokratischen Regeln der Schule zu unterwerfen, muß mit teilweise drastischen Konsequenzen rechnen. Tendenziell führen diese Maßnahmen nicht dazu, das von der Schule proklamierte Ziel zu erfüllen, nämlich selbstbestimmte, kreative, weltoffene, tolerante, friedliche und soziale Mitmenschen „heranzubilden“. Faktisches Ergebnis der heutigen Schulen ist statt dessen überwiegend der eher wenig an Gleichberechtigung interessierte Mensch, der vorgefundene Machtverhältnisse und Rollenverteilungen hinnimmt bzw. für sich ausnutzt, der sich also je nach Lebenssituation und Eigenwahrnehmung entweder demütig oder ängstlich fügt oder aber seine Interessen auf egoistische und wenig rücksichtsvolle Weise unter Zuhilfenahme seiner Ellenbogen mit Macht durchsetzt.
Die Schulen in Deutschland werden ihren Bildungsansprüchen nicht gerecht. In Wirtschaft und Gesellschaft herrscht deutliche Unzufriedenheit mit dem Können und Wissen der Schulabgänger. Auch nach jahrelangem Schulbesuch ist vermeintliches Grundwissen bei vielen Menschen nicht vorhanden – selbst wenn entsprechende Inhalte Gegenstand des Pflichtunterrichts waren. 10% der Schulabgänger erhalten keinen Schulabschluß – also nicht mal den Hauptschulabschluß. Bis zu 30% der Schüler nehmen Nachhilfe-Unterricht in Anspruch (Elternbefragung in Nordrhein-Westfalen, 2001). Die mehr als 15 000 000 €, die jede Woche in Deutschland für Nachhilfeunterricht ausgegeben werden, scheinen jedoch nicht dem tatsächlichen Bedarf zu entsprechen, da aus der oberen sozialen Schicht doppelt so viele Schüler Nachhilfe bekommen wie in der unteren (Hurrelmann/Klocke, 1994). Etwa 4 000 000 Menschen über 14 Jahren können nicht lesen und schreiben.
Die Schulgesetze der einzelnen Bundesländer lassen nur wenig Platz für Alternativen zu den traditionellen Staatsschulen. Nichtstaatliche Schulen sind an enge Vorgaben gebunden, die grundlegend andere Schulkonzepte kaum möglich machen. Ein Großteil der insgesamt ca. 40 Freien Alternativschulen, die zusammen nur etwas über 1000 Grundschüler umfassen, ist erst nach teils jahrelangem Rechtsstreit genehmigt worden. Auch nach der Genehmigung werden nichtstaatliche Schulen finanziell erheblich benachteiligt, so daß sie ohne Schulgeld nicht überleben können. Auf diese Weise hindert der Staat Kinder aus Familien mit geringem Einkommen tendenziell am Besuch von Schulen anderer Konzeptionen.
Im jetzigen Schulsystem kommen junge Menschen praktisch nicht als Subjekte vor, sondern nur als Objekte staatlichen Handelns. Menschenrechte wie physische Freiheit, Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit, Recht auf freie Berufswahl, freie Teilnahme am kulturellen Leben, Religionsfreiheit, Schutz vor Eingriffen ins Privatleben und sogar Gedankenfreiheit werden nicht geachtet und für verzichtbar erklärt; sie passen nicht in das übliche Menschenbild, das Schule von jungen Menschen hat.
Schule ist derzeit ein Ort, an dem sich die meisten Kinder und Jugendlichen nicht wohlfühlen.
Viele Menschen glauben, daß das „leider so sein muß“. Diese Menschen meinen das größtenteils nicht böswillig, sondern können sich schlicht nicht vorstellen, wie es anders gehen könnte. „Lernen in Freiheit“ unternimmt den Versuch, ein mögliches Bildungssystem zu beschreiben, das den Ansprüchen von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gerecht wird.
Lernen ohne Druck und Zwang
Viele Menschen wollen an Schulpflicht und Lernzwang festhalten, weil sie befürchten, daß Kinder sonst nichts mehr lernen würden.
Freie und Demokratische Schulen, in denen die Schüler selbst entscheiden, was, wann und wie sie lernen, zeigen, daß Kinder zum Lernen nicht gezwungen, gedrängt oder überredet werden müssen. Menschen haben ein natürliches, angeborenes Lernbedürfnis. Kinder sind neugierig und wollen lernen. Sie wollen die Welt, die sie umgibt, begreifen.
Die zentrale Sorge der Skeptiker der Lernfreiheit gilt meist der Frage, ob Kinder denn von sich aus Lesen, Schreiben und Rechnen lernen werden. Diese Grundfertigkeiten werden – zurecht – überall in der Gesellschaft für so wichtig gehalten, weil sie aus dem Lebensalltag kaum wegzudenken sind. Doch gerade deshalb sind auch Kinder z.B. ständig mit Geschriebenem konfrontiert: Wenn man als junger, neugieriger Mensch überall Zeichen sehen würde, die für einen wie Unsinn aussehen, die aber jeder um einen herum versteht – würde man es dann nicht auch können wollen? Schließlich kann man dann Comics, Hinweisschilder, Briefe und Bücher selbst lesen und ist weniger abhängig von lese- und schreibkundigen Menschen. Außerdem ermöglicht einem das Lesen-Können, Dinge, die einen interessieren, selbständiger zu lernen. Auch wer das Internet benutzen will, ist auf das Lesen angewiesen. Selbst in Computer- und Videospielen kommt Schrift vor. Es ist nahezu unvorstellbar, daß ein Kind in so einer Umgebung nicht früher oder später den praktischen Nutzen des Lesens und Schreibens erkennt.
Der Wunsch, lesen zu können, tritt aber nicht bei jedem Menschen mit genau 6 Jahren auf, sondern bei manchen vielleicht erst mit 9 oder 10 Jahren, bei anderen hingegen schon mit 4 Jahren. Aber sobald Kinder von sich aus Lesen und Schreiben gelernt haben, merkt man ihnen nicht an, in welchem Alter sie es gelernt haben.
Wir finden es eigentlich etwas seltsam, daß gerade Lernen ohne Zwang so häufig mit Analphabetentum assoziiert wird, obwohl es doch das staatliche Pflichtschulwesen ist, das eine beträchtliche Zahl von Analphabeten hervorbringt. In Deutschland können etwa 4 000 000 Menschen über 14 Jahren nicht lesen und schreiben.
Ebenso wie das Lesen und Schreiben kommen im Alltagsleben häufig Situationen vor, in denen mathematische Grundkenntnisse – Grundrechenarten, Bruch- und Prozentrechnung – von Nutzen sind, insbesondere im Zusammenhang mit Geld. Ähnlich wie beim Lesen und Schreiben wollen Kinder auch früher oder später eigenständig mit Geld umgehen können.
Was auch immer Menschen lernen – am effektivsten lernen sie, wenn ihnen das zu Lernende bedeutend erscheint. Dinge, die sie nicht interessieren, vergessen sie schnell wieder. Entscheidend für erfolgreiches und langanhaltendes Lernen ist eine eigene, innere Motivation. Sie beschleunigt das Lernen erheblich: sobald jemand sich entschlossen hat, eine Sache zu lernen, benötigt er dafür nur einen Bruchteil der sonst üblichen Zeit. Es lohnt sich, den Kindern die Entscheidung zu überlassen, wann sie was lernen. Die Bereitschaft, eine Sache zu lernen, läßt sich nicht verordnen.
Darüber, daß man Lesen, Schreiben und Rechnen können sollte, mag noch weitgehende Einigkeit bestehen. Doch was Menschen darüber hinaus wissen sollten, ist umstritten und hängt wesentlich davon ab, in welchen Kreisen man verkehrt. Im Grunde gibt es keine Lerninhalte, die tatsächlich absolut notwendig sind; Wissen und Fähigkeiten sind stets nur bedingt notwendig. Wenn jemand eine bestimmte Sache erreichen will, muß er dazu dieses oder jenes können oder wissen – wenn nicht, dann nicht.
Es erscheint uns weder nötig noch sinnvoll, von allen zu verlangen, das gleiche zu lernen. Trotz verbindlicher Lerninhalte in der Schule wissen Erwachsene nicht alle das gleiche. Die meisten Menschen beherrschen nur das, wofür sie sich interessieren, während sie den Rest wieder vergessen (oder erst gar nicht gelernt) haben. Doch obwohl sie über einen Großteil des vermeintlich wichtigen Fachwissens, das alle in der Schule lernen mußten, kaum Bescheid wissen, bereitet ihnen das im alltäglichen Leben fast nie Probleme.
Häufig wird gegen völlige Lernfreiheit eingewandt, daß Kinder noch nicht wissen könnten, welches Wissen bzw. welche Fähigkeiten sie einmal brauchen werden. In unserer sich immer schneller verändernden Welt kann jedoch auch kein Erwachsener sagen, welches Wissen heutige Kinder in Zukunft als Erwachsene brauchen werden.
Es lohnt sich nicht, alles mögliche auf Vorrat lernen. Bei der riesigen und immer größer werdenden Menge an weltweit verfügbarem Wissen wäre das auch gar nicht möglich. Man kann Dinge dann lernen, wenn absehbar ist, daß man sie braucht. Wenn man etwas konkretes wissen will, kann man es in einem Lexikon nachschlagen, im Internet danach suchen oder jemanden fragen. Viele Fakten, Zahlen und Zusammenhänge wird jeder aufmerksame Mensch im Laufe der Zeit ganz nebenbei hier und da aufschnappen.
Wichtiger als das Auswendiglernen von Faktenwissen ist die Fähigkeit, sich in neuen Situationen zurechtzufinden und mit neuen Informationen umzugehen. Vor allem kommt es darauf an; die bei jedem Menschen anfangs vorhandene Freude am Lernen zu erhalten.
Viele Leute glauben, wenn man aufhört, Kindern vorzuschreiben, was sie zu welchem Zeitpunkt lernen sollten, müßten sich die Kinder bereits mit 6 Jahren festlegen, welche Themen sie in ein paar Jahren lernen werden: Wenn sie nicht mit 6 Jahren anfingen, Mathematik zu lernen, hätten sie keine Möglichkeit mehr, mit 13 Jahren Physik zu lernen. Diese Vorstellung geht jedoch von einem äußerst starren Schulsystem (wie etwa unserem heutigen) aus, in dem es jeweils nur einen Punkt gibt, an dem man anfangen kann, sich mit bestimmten Themengebieten zu beschäftigen, weil später „der Zug abgefahren“ sei.
Da man zum einen die für das Lernen so wichtige von innen kommende Motivation nicht verordnen kann und zum anderen Menschen jeden Alters bei vorhandener Motivation erheblich schneller und mit dauerhafterem Erfolg lernen, muß das Bildungswesen so konzipiert werden, daß ein Schüler im wesentlichen jederzeit anfangen kann, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen.
Junge Menschen, die in Freiheit aufwachsen, wollen im Leben zurechtkommen. Sie lernen deshalb nicht nur die Dinge, die sie unmittelbar interessieren, sondern lassen sich auch auf unangenehme Aktivitäten ein, wenn sie die Grundlage für etwas sind, das sie interessiert, oder wenn sie ihnen helfen, andere Dinge zu erreichen, z.B. den gewünschten Beruf zu bekommen oder die Zugangsvoraussetzung für eine Universität zu erfüllen.
Gerade in einer Umgebung, die frei von Lernzwang ist und in der Kinder selbst die Verantwortung für ihr Lernen tragen, statt blind den Vorgaben anderer zu folgen, nehmen sie aufmerksam Notiz davon, womit andere Kinder und Jugendliche gleichen oder höheren Alters sich beschäftigen. Sie sind sich also auch dessen bewußt, womit sie sich noch nicht gut auskennen. Und wenn dieses Wissen oder diese Fähigkeiten für sie von Bedeutung sind, werden sie sich auch darum kümmern.
Lernzwang ist nicht nur einfach unnötig; er richtet auch erheblichen Schaden an. Zum einen ist Zwang eine Bedrohung, die Angst hervorruft. Unter Angst kann man jedoch kaum lernen, weil man seine Aufmerksamkeit viel mehr auf die Bedrohung als auf das eigentlich zu Lernende richtet. Die Angst läßt einen teilweise auch in Panik geraten, wodurch Denkblockaden entstehen.
Wenn Menschen lernen, tun sie das mit allen Sinnen. Wissen wird im Gehirn nicht einfach zusammenhangslos abgelegt. Wenn man das erworbene Wissen später wieder aufruft, erinnert man sich meist auch an die Umstände, unter denen man mit dem Thema zu tun hatte, also z.B. an bestimmte Unterrichtssituationen. Wenn in der traditionellen Schule massiver Zwang die Schüler also doch dazu bringt, mühsam, lustlos und gegen den eigenen Willen eine bestimmte Sache zu lernen, werden sie diese Sache stets mit der unangenehmen Zwangslernsituation assoziieren. Um sich diese unangenehmen Gefühle zu ersparen, versuchen sie dann, solchen Themen, möglichst selten über den Weg zu laufen, ihnen auszuweichen. Allein das Stichwort „Mathe“ oder „Latein“ genügt dann, um sie zusammenzucken und auf sichere Distanz gehen zu lassen. Das Ausüben von Druck und Zwang senkt also die Wahrscheinlichkeit, daß jemand sich mit dem jeweiligen Thema später wieder beschäftigen will. Wenn jemand etwas nicht lernen wollte, aber dennoch gezwungen wurde, wird er es später – wenn nicht gerade eine Gehirnwäsche dazwischen kommt – entweder nie wieder benutzen oder wenn doch, darunter leiden. Daher bringt die Qual noch nicht mal etwas. Eine weitere Folge des situationsbezogenen Lernens ist, daß viele Schüler das gelernte zwar in einer Leistungsüberprüfung wiedergeben können, es aber nicht in außerschulischen Situationen anwenden können.
Viele Menschen glauben, daß am ehesten Jugendliche mit der Lernfreiheit zurechtkämen, während kleine Kinder damit überfordert wären. Die Erfahrung von Demokratischen Schulen zeigt jedoch das Gegenteil. Kleine Kinder bringen so viel Energie und Neugier mit. Für sie gibt es noch so viele spannende Dinge zu entdecken. Wohingegen es Jugendlichen, die über eine lange Zeit zum Lernen gezwungen worden sind, wesentlich schwerer fällt, aus eigenem Antrieb zu lernen. Aber nur weil sich Jugendliche erst auf ein selbstgesteuertes Lernen umstellen müßten, heißt das nicht, daß man sie ruhig weiter zwingen kann. Eine Erholung von den Schäden, die das Zwangslernen angerichtet hat, ist nur in Freiheit möglich.
Die in einer freien Lernumgebung entstehende Spontanität, Lebendigkeit und Kreativität läßt sich durch keinen Lehrplan festlegen. Tiefgründiges und über die Schulzeit hinaus anhaltendes Lernen läßt sich nicht erzwingen – aber es kann in Freiheit wachsen.
Grundlagen eines freiheitlich-demokratischen Bildungssystems
Ein freiheitlich-demokratisches Bildungswesen muß auf diesen Erkenntnissen über das Lernen aufbauen, und es darf die freie Entfaltung der Persönlichkeit der jungen Menschen nicht behindern. Außerdem muß selbstverständlich sein, daß niemand benachteiligt wird, sei es wegen einer Behinderung, seiner wirtschaftlichen Lage oder anderen Gründen, für die er nichts kann.
Für ein pluralistisches Bildungssystem ohne Schulpflicht
Innerhalb der Strukturen des jetzigen Schulsystems lassen sich diese Ansprüche nicht verwirklichen. Vor allem das Ziel, daß jeder Schüler auf die Weise lernen kann, die ihm am besten gefällt, kann in einem zentralistischen Bildungswesen kaum erreicht werden. Schließlich gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie eine perfekte Lernumgebung aussieht. Und die lassen sich nicht alle in nur einem einzigen Schultyp zusammenfassen – egal wie genial und wie offen dieses Einheits-Schulform wäre. Um den Bedürfnissen wirklich aller jungen Menschen gerecht werden zu können, muß es deshalb ein pluralistisches Bildungssystem geben.
Ein Bildungswesen, das die Interessen der Hauptbeteiligten – also der Kinder und Jugendlichen – in den Mittelpunkt stellt, muß nachfrageorientiert arbeiten. Nur so kann erreicht werden, daß Kinder und Jugendliche selbst bestimmen, was sie lernen, wie, wo, wann und von wem sie es lernen. Es darf nicht nur vom Staat festgelegte Schultypen geben. Keine Verwaltung kann alle möglichen Schulmodelle erdenken. Aber diejenigen, die täglich von Schule betroffen sind, also vor allem die Schüler und Lehrer, aber auch Eltern, haben durchaus eigene Ideen, die sie in selbstgeschaffenen Strukturen umsetzen möchten. Eigeninitiative darf hier nicht verboten sein. Das staatliche Schulmonopol muß daher abgeschafft werden.
Wenn sie allen Menschen gleichermaßen offenstehen, sind sogenannte „Privatschulen“, d.h. Schulen in nicht-staatlicher Trägerschaft, überhaupt nichts elitäres. Sie sind einfach Schulen von unten.
In einem pluralistischen Bildungssystem kann es die verschiedensten Einrichtungen und Veranstaltungen geben – auch Schulen, die wie die jetzigen Staatsschulen funktionieren.
Es muß nur der Grundsatz gelten, daß niemand gezwungen werden darf, eine bestimmte Einrichtung oder Veranstaltung zu besuchen, mit anderen Worten: Die Schulpflicht muß wieder aufgehoben werden. Statt dessen muß jeder junge Mensch ein einklagbares Recht auf Bildung haben. Der Wegfall der Schulpflicht ist kein gesellschaftlicher Rückschritt, sondern die Korrektur einer Entscheidungen, die erstens auf falschen Annahmen über das Lernen beruht und zweitens aus einer Zeit stammt, in der Persönlichkeitsentfaltung und Freiheitsrechte Fremdworte waren. Selbst wenn man die Schulpflicht im 19. Jahrhundert für gutheißen mag, rechtfertigt das nicht ihr Fortbestehen im 21. Jahrhundert.
Das Kind entscheidet
Die zur Zeit sehr weitreichenden Kompetenzen des Staates einfach auf die Eltern zu übertragen – wie es in einigen europäischen Staaten der Fall ist –, kommt für eine wirklich freiheitliche Gesellschaft nicht in Frage. Denn Fremdbestimmung bleibt Fremdbestimmung, egal von wem sie ausgeübt wird. Wenn die Eltern entscheiden würden, käme es in einigen Fällen dazu, daß die Kinder gegen ihren Willen in Schulen landen, die die jetzigen Staatsschulen an Leistungsdruck und Unterdrückung noch um einiges übertreffen. Verhindert werden kann dies in einer vielfältigen Bildungslandschaft nur, wenn die tatsächlich Betroffenen – die Schüler – sich ihre Schule/Bildungsstätte selbst aussuchen dürfen. Wenn es auch Schulen gibt, die intern undemokratisch organisiert sind, so müssen die Schüler doch wenigstens frei entscheiden dürfen, ob sie sich dem aussetzen. Es kann nicht sein, daß die jungen Menschen von der Willkür bzw. Gnade ihrer Eltern abhängig sind.
Aufgabe der Eltern wäre es, ihre Kinder bei der Wahl der Bildungsangebote zu beraten, ihnen mögliche Folgen zu erklären. Wenn Eltern die Entscheidung ihres Kindes für falsch halten, können sie versuchen, es zu überzeugen. Zwang ausüben dürften sie nicht mehr. Entsprechend den obigen lerntheoretischen Erkenntnissen muß die grundsätzliche Abwesenheit von Zwang für Kinder jeden Alters gleichermaßen gelten.
Aufgaben des Staates
Die Aufhebung des derzeitigen faktischen staatlichen Schulmonopols entläßt den Staat allerdings nicht aus der Verantwortung. Das Recht auf Bildung zu garantieren und damit auch finanziell abzusichern, bleibt Aufgabe des Staates. Träger von Bildungseinrichtungen können aber neben dem Staat verstärkt auch Initiativen und Vereine sein. Diese arbeiten dann als non-profit-organisations, dürfen also durch den Betrieb einer Bildungseinrichtung keinen Gewinn machen. Daher wäre die Aufhebung des faktischen Schulmonopols nicht die sooft befürchtete Privatisierung der Bildung.
Zur Dezentralisierung des Bildungswesens gehört natürlich auch, daß die Bildungseinrichtungen ihre eigenen Angelegenheiten selbst regeln. Dazu zählen unter anderem die Einstellung von Lehrern und sonstigem Personal sowie die Anschaffung neuer Ausstattung und die sonstige Verwendung der Gelder.
Eine weitere Aufgabe des Staates oder eines gewählten „Bildungskontrollrates“ wäre es, den Überblick über die aktuell bestehenden Bildungsangebote zu haben. Eine Liste dieser Bildungsangebote kann so auch Schülern helfen, sich für eine Einrichtung zu entscheiden. Zudem können Schulen/Bildungseinrichtungen sich dadurch untereinander einfacher vernetzen und durch Mitnutzung der Ressourcen anderer Einrichtungen ihr Bildungsangebot vergrößern.
Auf der Grundlage dieser Listen kann der Bildungskontrollrat feststellen, ob die Angebote der Nachfrage entsprechen. Sollten einzelne Gegenden oder Themengebiete unterversorgt sein, wäre der Staat verpflichtet, solche Angebote in hinreichender Anzahl einzurichten bzw. entsprechende Förderungen vorzunehmen.
Mit Hilfe eines zu gründenden Amtes für freie Wahl der Bildung (grob vergleichbar dem Jugendamt) ist der Staat den Kindern und Jugendlichen bei der Durchsetzung ihres Rechts auf selbstbestimmte Bildung behilflich.
Existenzberechtigung staatlicher Schulen
Das Recht auf selbstbestimmte Bildung schließt mit ein, daß der Staat auch Schulen zur Verfügung stellt, in denen selbstbestimmte Bildung tatsächlich möglich ist. Die Möglichkeit, freie und demokratische Schulen in privater Trägerschaft zu gründen, reicht daher nicht.
Die Aufhebung des staatlichen Schulmonopols bedeutet also nicht, daß es keine staatlichen Schulen mehr gibt, sondern nur, daß nicht-staatliche Schulen keine Besonderheit mehr sind.
Außerdem ist die Ausgangslage, daß es jede Menge staatlicher Schulen gibt. Und nur weil die derzeitigen Staatsschulen unzumutbar sind, muß man ja nicht gleich dafür sein, staatliche Schulen an sich abzuschaffen. Das schlimme an den heutigen Staatsschulen ist nicht, daß sie sich in staatlicher Trägerschaft befinden, sondern daß von ihnen Grundrechtsverletzungen ausgehen und es in ihnen keine ernsthafte und demokratischen Prinzipien entsprechende Mitbestimmung für die Schüler gibt. Wenn der Staat Träger von Schulen ist, muß er diese Übel beheben.
Diese veränderten Staatsschulen stehen den Schülern genauso zur Auswahl wie alle möglichen nicht-staatlichen Schulen der unterschiedlichsten Konzeptionen. Weil keinem Kind und keiner Familie zugemutet werden kann, sich Schulen, die freiheitlich-demokratischen Grundsätzen entsprechen, im Bedarfsfall erst selbst gründen zu müssen, muß ihr flächendeckendes Vorhandensein durch den Staat garantiert werden.
(Entsprechend reformierte) Staatsschulen sind also nicht nur deshalb notwendig, weil die neugebildeten Bildungseinrichtungen zunächst von ihrer Anzahl her nicht in der Lage sein werden, sämtliche staatlichen Schulen zu ersetzen, sondern auch, weil – selbst wenn es insgesamt genug nicht-staatliche Schulen geben sollte – fraglich ist, wie viele davon tatsächlich selbstbestimmtes Lernen ermöglichen. Es wäre z.B. vorstellbar, daß zwar zahlreiche Eltern und bisherige Lehrer aus allgemeinem Engagement Schulen gründen, dort aber nur ihre eigenen pädagogischen Vorstellungen durchsetzen wollen, statt die Interessen der Kinder und Jugendlichen zu achten.
Im Laufe der Zeit wird sich ein sinnvolles Verhältnis von staatlichen und nicht-staatlichen Schulen einstellen. Wie groß der Anteil staatlicher Einrichtungen am Ende sein wird, wird man ja sehen.
Darüber, wie reformierte Staatsschulen aussehen können, gibt es verschiedene Ansichten. Die beiden nachfolgend beschriebenen Schultypen, die sich gegenseitig ergänzen und auch zeitgleich in Anspruch genommen werden können, erfüllen die Anforderungen von Demokratie und selbstbestimmtem Lernen besonders gut.
Im ersten Typ Schule findet Lernen in einer sehr lebensnahen Umgebung und ohne Lehrplan statt. Der zweite Typ wird von einem umfassenden Angebot von Kursen, Vorlesungen und Veranstaltungen geprägt.
Wenn sich diese Schultypen in einer Versuchsphase als sinnvoll erweisen, wird der Staat eine der Nachfrage entsprechende Anzahl einrichten.
Konkrete Bildungsmöglichkeiten
Schultyp 1: Sudbury-Schulen
Vor allem der erste Schultyp, der hier im folgenden beschrieben werden soll, mag utopisch klingen, ist jedoch lebendige Realität: Die älteste dieser Schulen, die Sudbury Valley School in Framingham (Massachusetts, USA), existiert schon seit 1968. Mittlerweile gibt es weltweit, auf vier Kontinenten, mehr als 30 Schulen nach dem Modell der Sudbury Valley School. Immer wieder hat sich in diesen Schulen eindrucksvoll gezeigt, mit welcher Freude, mit welcher Konzentration und welch beachtlichen Ergebnissen Kinder und Jugendliche in Freiheit Lernen. Die Sudbury Valley School ist ein wahres „Erfolgsmodell“, das nun hier als staatliches Bildungsangebot in Serie gehen könnte.
Allgemeines
Diese Schule umfaßt zwischen etwa 20 und 250 Schülern und je nach Schülerzahl drei bis zwölf Mitarbeiter. Die jüngsten Schüler sind etwa vier Jahre alt, die ältesten ungefähr 20. Das „Eintrittsalter“ variiert von Schüler zu Schüler, aber grundsätzlich ist es nie zu spät, Schüler dieser Schule zu werden, und aufhören kann man natürlich auch zu jeder Zeit.
Die Schüler können den ganzen Tag über tun und lassen, was sie wollen, sofern sie dabei niemand anderes stören. Sie können die Schule und das Schulgelände jederzeit und ohne Begründung verlassen. Es gibt keine Pflichtveranstaltungen, höchstens gegenseitige freiwillige Vereinbarungen zwischen Mitarbeitern und Schülern und auch zwischen Schülern untereinander.
Schüler und Mitarbeiter sind völlig gleichberechtigt. Die Schüler duzen die Mitarbeiter und reden sie mit dem Vornamen an, und umgekehrt ist es natürlich genauso. Die Beziehungen zwischen den Schülern und den Mitarbeitern unterscheiden sich kaum von den Beziehungen der Schüler untereinander. Die Atmosphäre in der Schule ist locker und familiär.
Die Schüler werden nicht nach dem Alter getrennt. Klassen gibt es nicht. Freundschaften und Interessengemeinschaften wie Lerngruppen entstehen über Altersunterschiede hinweg.
Leben und Lernen
Unterricht im herkömmlichen Sinne ist die Ausnahme und kommt nur zustande, wenn Schüler dies ausdrücklich wünschen. Lernen ist voll im Leben integriert. Daß die Schule ein Lebensort ist, zeigt sich auch daran, daß sie ähnlich wie eine große Wohnung eingerichtet ist. Klassenräume gibt es nicht.
Einige sitzen still irgendwo in der Gegend und lesen ein Buch, andere unterhalten sich oder diskutieren über irgend etwas und noch andere spielen, machen Sport, surfen im Internet, lesen Zeitung, zeichnen, machen Musik, träumen, usw. Irgendeine Sache klappt nicht so, wie man es sich gedacht hatte, also überlegt man, wie man das Problem lösen kann. Man will irgendwas wissen, also versucht man, es herauszufinden. Manche Sachen probiert man einfach aus, andere läßt man sich von jemandem erklären. Einen Teil lernt man dadurch, daß man Erwachsenen zusieht, wie sie eine Sache tun, oder dadurch, daß man es mit ihnen zusammen tut. Aber das meiste, was man lernt, lernt man von anderen Kindern; und es hat mit dem Leben zu tun – wie man lebt und wie Sachen geschehen. Das meiste kommt vom Herumsitzen und Reden: ein Gedanke kommt auf und entwickelt sich von sich aus weiter. Oft ist einem gar nicht bewußt, daß man lernt. Lernen passiert ganz natürlich, wie atmen auch. Hier wird nicht Zeit abgesessen, sondern hier findet aktives Leben statt.
Daß es in so einer Schule keinen Lehrplan gibt, ist klar. Jeder beschäftigt sich damit, wofür er sich interessiert. Niemand kann einen anderen zum Lernen zwingen. Jeder Schüler entscheidet selbst, welche Themen wichtig sind, und welche nicht. Der Schüler hat die volle Verantwortung für sein Lernen und seine Aktivitäten an der Schule. Niemand hat das Recht, sich in seine Aktivitäten einzumischen – solange der Schüler durch diese nicht das Recht anderer, das gleiche zu tun, verletzt. Es gibt keine Höherbewertung akademischer Themen gegenüber anderen Beschäftigungen. Auch sind die Schüler keiner ständigen Aufsicht durch die Mitarbeiter ausgesetzt.
Die Mitarbeiter drängen sich also nicht auf, sondern stehen zur Verfügung. Da die Schüler hauptsächlich alleine oder von anderen Kindern lernen und Erwachsene nur gelegentlich zu Rate ziehen, werden an Sudbury-Schulen insgesamt nicht so viele Mitarbeiter benötigt wie an traditionellen Schulen. Und während es an den meisten Schulen Lehrer, Hausmeister, Reinigungspersonal und Verwaltungsleute als getrennte Berufe gibt, gibt es an Sudbury-Schulen einfach nur Mitarbeiter. Falls gerade kein Schüler ihre Mitarbeit benötigt, kümmern sich die Mitarbeiter z.B. um Verwaltungsarbeit oder gehen ihren eigenen Interessen nach.
Zensuren oder andere vergleichbare Bewertungen gibt es natürlich nicht. Wer eine Rückmeldung über seine Fähigkeiten haben will, kann einen Mitarbeiter oder andere Schüler um eine Einschätzung bitten. Wer dies unbedingt will, kann sich auch freiwilligen Tests unterziehen, die dann nur dem Schüler zur Information dienen, zu mehr nicht.
Im Laufe der Zeit entwickeln die Schüler spezielle Interessen, denen sie sehr ausgiebig nachgehen, zum Beispiel Musikinstrumente spielen, Computer programmieren, Latein lernen, Philosophie, höhere Mathematik, Quantenphysik, Chemie, usw. Meistens beschäftigen sie sich mit diesen Sachen nicht deshalb, weil sie in ihrem Leben eine Rolle spielen würden, sondern weil sie sich selbst herausfordern wollen. Die Schüler tun überwiegend nicht die Sachen, die ihnen leicht fallen, sondern gerade die, die ihnen schwer fallen. Sie sind sich ihrer Stärken und Schwächen sehr bewußt und arbeiten hart an Letzteren. Und wenn sie etwas nicht auf Anhieb schaffen, versuchen sie es eben noch mal und noch mal, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Sie erreichen Höchstleistungen, die nicht durch Drill und Zwang, sondern nur durch Freiwilligkeit erreicht werden können.
Organisation
Alle Angelegenheiten, die mit dem alltäglichen Betrieb der Schule zu tun haben, werden auf der wöchentlichen Schulversammlung geregelt, bei der jeder Schüler und jeder Mitarbeiter der Schule eine Stimme hat. Da die Schüler in der Überzahl sind, kann die Schulversammlung praktisch keine grundsätzlich gegen die Interessen der Schüler gerichteten Entscheidungen treffen. (Schülervertretung im klassischen Sinne ist innerhalb dieser Schule damit überflüssig.) Die Teilnahme an den Schulversammlungen ist keine Pflicht, aber wer fehlt, kann weder seine Ansichten einbringen noch mitbestimmen.
Sudbury-Schulen sind durchaus nicht „Schulen ohne Regeln“. Aber diese Regeln werden von der Schulversammlung diskutiert und auf demokratische Weise beschlossen.
Eine weitere Aufgabe dieses Gremiums ist die Bestimmung von Zuständigen für bestimmte Angelegenheiten, z.B. Grundstückpflege, Gebäudeerhaltung, Büroarbeiten, Einführungsgespräche mit Schülern, die sich an dieser Schule einschreiben wollen, sowie mit deren Eltern. Für Angelegenheiten, für die es nicht nur einen einzelnen Zuständigen geben soll, kann die Schulversammlung beschließen, Komitees einzurichten, z.B. für die Einrichtung und Gestaltung der Schule. Je nach Bedarf können auch das Amt von konkreten Zuständigen wieder abgeschafft bzw. Komitees aufgelöst werden.
An den meisten Schulen bekommen die Schüler die Lehrer bzw. sonstigen Angestellten einfach vorgesetzt; an Sudbury Valley wird einmal im Jahr von der Schulversammlung darüber abgestimmt, wer im nächsten Jahr als Mitarbeiter weiterbeschäftigt bzw. neu eingestellt wird. Mitarbeiter, die nicht nur von einigen Schülern, sondern von der Mehrheit, nicht gewollt werden, müssen dann nach einem Jahr wieder gehen. Allerdings wollen sie dann wahrscheinlich auch gar nicht an so einer Schule tätig sein. Im Prinzip ist das wie bei Politikern, die ja auch nicht – etwa aus arbeitsrechtlichen Gründen – automatisch im Amt bleiben, sondern sich regelmäßig wiederwählen lassen müssen. Die Wahl ist Ende Mai, und nicht wiedergewählte Mitarbeiter müssen dann zum Beginn des nächsten Schuljahres ausscheiden, so daß die Entlassung auch nicht allzu kurzfristig ist. Außerdem zeigt sich meist schon im Laufe des Schuljahres, wer gute Chancen hat. Und wenn Mitarbeiter die allgemeine (bzw. mindestens mehrheitliche) Zufriedenheit der Schulgemeinschaft finden, werden sie schließlich auch wiedergewählt.
Eltern können sich mit ihren Ideen einbringen und der Schule als Berater zur Seite stehen. Unmittelbare Mitbestimmung ist für die Eltern nicht vorgesehen, da sie nicht direkt von den Entscheidungen betroffen sind. (Bei diesem Punkt besteht eine Abweichung vom eigentlichen Konzept des Sudbury-Modells, das bei einer u.a. für den Finanzhaushalt der Schule zuständigen übergeordneten jährlichen Versammlung auch den Eltern ein Stimmrecht gibt.)
Eine faire Justiz gehört nicht nur zu einem freiheitlich-demokratischen Staat, sondern auch zu einer ebenso verfaßten Schule. Beschwerden über die Verletzung von Regeln werden von einem Justizkomitee untersucht, das auch berechtigt ist, Strafen auszusprechen. Das Justizkomitee besteht z.B. aus acht Leuten; zu zwei von der Schulversammlung direkt gewählten Vorsitzenden kommen fünf zufällig ausgewählte Schüler und ein Mitarbeiter. Die Besetzung des Justizkomitees kann z.B. monatlich neu bestimmt werden.
Auf eine Beschwerde folgt zunächst eine Untersuchung der Umstände. Ist diese abgeschlossen und die Beschwerde nicht offensichtlich unbegründet, wird eine Anklageschrift verfaßt, in der die vermuteten Regelverletzungen nochmals genau benannt werden. Bekennt sich der Beschuldigte für „schuldig“, kann sofort ein Urteil gefällt werden, andernfalls gibt es eine Verhandlung, in der Zeugen geladen werden können und die beschuldigte Person umfassende Möglichkeiten zur Verteidigung hat. Jeder Beschuldigte gilt dabei solange als unschuldig, bis die Verletzung einer Regel tatsächlich nachgewiesen werden konnte. Urteile, die als ungerecht empfunden werden, können angefochten und müssen dann vor der Schulversammlung erneut diskutiert und abschließend entschieden werden. Diese Verfahrensweise ist nicht ganz unbürokratisch, wird dafür aber von allen als gerecht empfunden. Und selbstverständlich werden nicht nur Schüler, sondern auch Mitarbeiter zur Verantwortung gezogen.
Ausstattung
Wenn eine Schule den Schülern vielfältige Bildungsmöglichkeiten bieten soll, muß sie auch entsprechend ausgestattet sein. Dazu zählt z.B. genügend Platz für alle Leute, so daß man sich bei Bedarf aus dem Weg gehen und sich zurückziehen kann. Um die Schule zu einem Ort zu machen, an dem die Schüler sich gern aufhalten, muß sie gemütlich eingerichtet werden.
Zu einer sinnvollen Ausstattung zählen vor allem auch vielfältige Materialien, mit denen die Schüler die Sachen, die sie wissen wollen, herausfinden können. Solche Materialien sind nicht nur Bücher aller Art, sondern auch sonstige Publikationen, Videos, CD-ROMs und genügend Internetzugänge. Zudem braucht man Computer mit aktueller Software, Möglichkeiten selbst Musik zu machen, verschiedenste Spiele und praktische Werkstätten für z.B. Holz- und Keramikarbeiten, eine Küche, ein möglichst großes und interessantes Außengelände, Möglichkeiten für sportliche Betätigung, Chemie- und Biolabor, Dunkelkammer, usw.
Da wahrscheinlich nicht jede Schule alle dieser Ausstattungsbestandteile hat, entsteht eine Kooperation mit anderen, auch außerschulischen, Einrichtungen.
Sonstiges
Die Schule und ihre Infrastruktur können den Schülern und Mitarbeitern auch weit über die Öffnungszeiten von derzeitigen Staatsschulen hinaus zur Verfügung stehen, also auch am Abend, am Wochenende und in der Ferienzeit. Da es keinen Unterricht im klassischen Sinne gibt, kann man auch keinen Unterrichtsstoff verpassen, wenn man nicht die gesamte Zeit in der Schule verbringt. Es ist also auch kein großes Problem, wenn Schüler außerhalb der eigentlichen Ferienzeiten, die dann nur noch in anderen Schultypen eine Rolle spielen, verreisen oder vormittags private Erledigungen machen, einkaufen gehen oder einfach nur ausschlafen. Gegebenenfalls muß die Vertretung in Zuständigenposten und dem Justizkomitee geregelt werden.
Da diese Schulen nur relativ wenige Schüler umfassen, entstehen einfacher soziale Bindungen, weil sich fast alle untereinander kennen und wesentlich mehr miteinander machen als in heutigen Staatsschulen.
Eine weitere Folge der geringen Schülerzahl pro Schule ist, daß es – sobald sie als ein Standardschultyp eingeführt ist – viel mehr einzelne Schulen gibt, die entsprechend dezentral verteilt sind, was einen kürzeren Schulweg mit sich bringt.
Wie oben schon erwähnt, ist dieser Schultyp, der umfassenden Freiheit und Demokratie garantiert, nicht frei erfunden, sondern mancherorts längst Realität. Und die Schüler sind in jeder Hinsicht außerordentlich erfolgreich. (Wer’s nicht glaubt, kann sich ausführlich auf der Website der Sudbury Valley School unter www.sudval.org informieren. Zahlreiche Texte auf deutsch gibt es auch unter de.kraetzae.de/schule/sudbury sowie unter www.sudbury-berlin.de)
Schultyp 2: Demokratische Schulen mit Kursangebot
Der zweite Typ staatlicher Schulen erinnert durchaus an Schulen im üblichen Sinne, mehr jedoch an Universitäten. Im wesentlichen besteht er aus einem System projekt- bzw. themenbezogener Kurse.
Da Kurse und Unterricht beim Lernen eine viel weniger bedeutende Rolle spielen als üblicherweise angenommen, ist zunächst eine kurze Erklärung angebracht, warum sie nun zentraler Bestandteil eines Schultyps sein sollen. Kurse sind eine vergleichsweise bequeme und durchaus unterhaltsame Art, etwas zu lernen, bei der man sich selbst nicht allzu viele Gedanken machen muß, sondern andere die Planung übernehmen. Der Lernende kann sich ohne große Anstrengung einen Überblick über viele verschiedene Themengebiete verschaffen. Auch sind Kurse eine Möglichkeit, wie der Staat seine Verpflichtung, Bildung anzubieten, erfüllen kann. Da Kurse andere Lernformen jedoch leicht ins Abseits drängen, ist es sinnvoll, wenn das Kurswesen seinen eigenen Schultyp bekommt.
Auch an diesem Typ Schule gilt die grundsätzliche Abwesenheit von Lernzwang. Es gibt keinen einzigen Kurs, den ein Kind oder Jugendlicher gezwungen wäre zu besuchen. Die Kurse verstehen sich also lediglich als Angebot. Jeder Schüler kann sich herauspicken, was er will.
In diesen Kursen wird so ziemlich alles angeboten, was von Interesse sein könnte, von Lesen und Schreiben lernen über Funktionsweise eines Kernkraftwerkes bis hinzu Japanisch und Integration von gebrochenrationalen Funktionen. Auch in der herkömmlichen Schule eher unübliche Themen wie z.B. Recht, Philosophie, Meteorologie, Astronomie, Ökologie, Landwirtschaft, Tischlern, Psychologie, Wirtschaft, Telekommunikationswesen, Journalismus und Fotografie werden angeboten. Diese Kurse müssen nicht alle tatsächlich stattfinden, aber eingerichtet werden können, wenn Schüler etwas darüber wissen wollen. Da fast zwangsläufig nicht alle Sachen, wofür sich die Schüler interessieren, im Grundangebot der Schule enthalten sind, können die Schüler weitere Kurse vorschlagen, für die dann jemand gesucht wird, der sie anbietet. Und andersherum kann jeder selbst Kurse anbieten, wenn er glaubt, daß es Interessenten dafür gibt.
Da die Kurse oftmals nur ein bestimmtes Thema umfassen, dauern sie oft nur wenige Wochen. Andere Kurse, z.B. Sprachen werden, halbjahresweise angeboten.
Hat man sich für einen Kurs eingeschrieben, so ist man – falls nicht anders vereinbart – verpflichtet, tatsächlich teilzunehmen, damit man nach mehrmaligem Fehlen nicht durch ständiges Nachfragen andere beim Lernen stört. Es kann vereinbart werden, daß Kursteilnehmer, die häufig ohne wichtigen Grund fehlen und dadurch die anderen beeinträchtigen, aus diesem konkreten Kurs ausgeschlossen werden können. In Einzelfällen kann sich ein Schüler natürlich mit Mitschülern und Lehrer darauf einigen, hin und wieder nicht anwesend zu sein, um andere für ihn wichtige Sachen zu tun.
Grundsätzlich hat jeder Schüler das Recht, jeden Kurs abzubrechen, ihn also nicht weiter zu besuchen. Er kann den Kurs dann später erneut belegen, wenn er möchte.
Dadurch, daß sich immer nur einigermaßen Interessierte in einen Kurs einschreiben, gibt es kaum Störer, und es herrscht eine produktivere Arbeits- und Lernatmosphäre.
Auch an diesem Typ Schule gibt es keine Trennung der Schüler nach ihrem Alter. Das ist auch deshalb notwendig, weil es sich ja um freiwillige, nachfrageorientierte Lerngruppen handelt und das Interesse für ein bestimmtes Thema nicht bei jedem zum gleichen Lebenszeitpunkt aufkommt.
Bei manchen Kursen muß man, um teilnehmen zu können, nachweisen, daß man über die dafür notwendigen Grundlagen verfügt. Wer z.B. einen der Physikkurse wählen will, muß von gewissen mathematischen Grundlagen eine Ahnung haben. Daß heißt nicht, daß er zuvor einen Mathekurs besucht haben muß, sondern nur, daß er sich damit hinreichend auskennen muß. Wann, wo, wie und von wem er sich geeignete Grundlagen aneignet, entscheidet jeder selbst.
Informationen darüber, welches diese notwendigen Grundlagen sind, müssen allen Schülern ohne nennenswerte Hürden zugänglich sein. Zudem muß es – sofern der Inhalt nicht erst im Verlauf des Kurses festgelegt wird – von möglichst allen Kursen Inhaltsbeschreibungen geben, damit Interessierte im Voraus wissen, was sie ungefähr erwartet. Auch Unentschlossenen kann so die Entscheidung einfacher gemacht werden.
Die konkreten Arbeitsweisen können höchst unterschiedlich sein und müssen bei weitem nicht immer der heutzutage üblichen Form (Lehrer steht vorne und erteilt Anweisungen) entsprechen.
Zensuren gibt es auch hier nicht. So etwas wie Sitzenbleiben ebenfalls nicht. Es kann aber sein, daß ein Schüler die Anforderungen für einen weiterführenden Kurs nicht erfüllt und sich deshalb entscheidet, den Vorgängerkurs noch einmal zu besuchen. In diesem Fall wiederholt er nur diesen einen Kurs – und nicht alle Kurse des letzten Jahres.
Natürlich gilt auch in den Demokratischen Schulen mit Kursangebot, daß die Lehrer keine Machtmittel haben, mit denen sie die Kinder erpressen könnten. Unabhängig von ihrem Alter sind alle an der Schule beteiligten Menschen gleichberechtigt. So muß es auch keine große Ausnahme sein, daß sich die üblichen Rollenverhältnisse vertauschen, daß es also Kinder und Jugendliche gibt, die Kurse leiten, und daß es Lehrer gibt, die sich in solchen von jungen Menschen geleiteten Kursen weiterbilden, beispielsweise über neue Computerprogramme oder Fremdsprachen.
Es kann übrigens auch Kurse geben, die aus losen Vortrags- oder Veranstaltungsreihen bestehen. Bei Bedarf können Honorarkräfte oder Referenten angefragt werden.
Um den Schulablauf organisatorisch einfacher und übersichtlicher zu machen, könnte das Prinzip der jetzigen Stundenpläne grundlegend umgestaltet werden. Man hätte am Tag nicht mehr bis zu sieben verschiedene Kurse, sondern im Normalfall vielleicht nur zwei. Der eine Kurs fände am Vormittag, der andere am frühen Nachmittag statt. Auf diese Weise müßte man sich auch nicht alle 45 Minuten auf ein anderes Thema einstellen, was die Sache sowohl für Schüler als auch für Lehrer erleichtert. Darüber, wie lange eine Unterrichtseinheit genau dauert und ob es zwischendurch eine Pause gibt, einigen sich die Kursteilnehmer untereinander. Da es bestimmte Kurse (zu wenig nachgefragten Themen) nicht an allen Schulen geben kann, ist eine Abstimmung der Kurszeiten unter den Schulen notwendig, so daß Interessierte auch Angebote anderer Schulen wahrnehmen können. Der Vormittagskurs könnte pauschal innerhalb der Zeit von z.B. 9.30 bis 12.30 Uhr stattfinden, der Nachmittagskurs zwischen 13 und 16 Uhr. Denkbar sind auch Kurse und Veranstaltungen am Abend. Wie viele junge Menschen an Abendveranstaltungen interessiert sind, wird sich zeigen.
Analog zu den Sudbury-Schulen werden Entscheidungen auch hier in Schulversammlungen gefällt, in denen jeder Schüler und jeder Lehrer eine Stimme hat, auch wenn dies bei hier einigen Hundert Schülern etwas schwieriger wäre. Auch das Justizsystem wird von den Sudbury-Schulen übernommen.
Insgesamt erfüllt dieser Schultyp in vollem Maße die Anforderung, daß die Menschenrechte der Kinder und Jugendlichen geachtet werden und Lernen selbstbestimmt ist.
Die Schule ist zwar insgesamt so organisiert, daß man seine Bildung im Prinzip fast ausschließlich von dort beziehen kann, die Schüler können sich aber auch dafür entscheiden, diese Schule nur teilweise zu nutzen und ihren sonstigen Bedarf an Wissen und Können woanders decken. Die Schule steht auch Schülern offen, die eigentlich in anderen Schulen eingeschrieben sind. Sie ist für andere Schüler wahrscheinlich vor allem dann attraktiv, wenn sie Kurse oder Projekte anbietet, die sich an der anderen Schule nicht durchführen lassen, z.B. weil sich kein Material oder Lehrer dafür finden läßt.
Andere Schulen
Da es sich um ein pluralistisches Bildungssystem handelt, wird es neben den beiden gerade beschriebenen staatlichen Schulangeboten noch eine mehr oder weniger große Anzahl an nicht-staatlichen Schulen geben. Welche dies im einzelnen sein werden, läßt sich kaum voraussagen.
Die bereits heute existierenden Demokratischen Schulen in aller Welt zeigen, auf welch unterschiedliche Weise freie demokratische Schulen arbeiten können. Allen gemein ist jedoch der Respekt vor Kindern, die garantierte Abwesenheit von Lernzwang sowie die Existenz von den Schulalltag betreffenden Entscheidungsstrukturen, in denen Kinder und Erwachsene gleichberechtigt sind.
Während in Sudbury-Schulen Unterrichtskurse keine große Rolle spielen und nur auf Initiative von Schülern eingerichtet werden, ist das Lernen in anderen Schulen großteils nicht durch die Schüler selbst initiert, d.h. die Schule bietet diverse Kurse gemäß der traditionellen Schulfächer an, an denen die Schüler teilnehmen können, aber nicht müssen. In der Regel können die Lehrer in solchen Schulen weitere Kurse oder Projekte zu Themen anbieten, die sie interessieren. Es gibt auch Schulen, in denen die Mitarbeiter zwar keine Kurse anbieten, aber die Lernumgebung immer wieder neu so präparieren, daß die Schüler dort jene Dinge entdecken, die die Erwachsenen wichtig finden.
In den meisten demokratischen Schulen gibt es eine wöchentliche Schulversammlung, in einigen tritt sie jedoch ohne festen Rhythmus zusammen, sobald Bedarf danach besteht. In den meisten Schulen werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Anwesenden gefaßt. Es gibt auch Schulen, die nach dem Konsensprinzip arbeiten, die dann allerdings nicht mehr wirklich als Demokratische Schulen bezeichnet werden können. In einigen Schulen sind die Versammlungen eher unförmlich, chaotisch und spontan, in anderen gibt es eine Geschäftsordnung mit formalisierten Verfahren, die eine effiziente Bearbeitung der Tagesordnung bewirken und verhindern, daß Leute überrollt werden.
Regeln und Regelverletzungen werden in verschiedenen demokratischen Schulen recht unterschiedlich gehandhabt. In einigen Schulen haben Schüler und Mitarbeiter eine enorme Zahl sehr detaillierter Regeln ausgearbeitet und haben für den Umgang mit Regelverletzungen eine gesonderte Schulversammlung oder ein Justizkomitee, das nach einem festgelegten Verfahren Sanktionen verhängen kann. Andere Schulen haben relativ wenige Regeln, unförmliche Verfahrensweisen und bevorzugen ausschließlich Mediationsverfahren anstelle eines Justizsystems.
Schulen können sich auch darin unterscheiden, inwieweit sie die Eltern der Schüler einbeziehen. In einigen Schulen dürfen Eltern z.B. über Finanzen mit abstimmen, in einigen haben sie ein Stimmrecht auch im alltäglichen Schulleben, in anderen überhaupt keines. In manchen Schulen wird die Anwesenheit von Eltern als störend empfunden, in anderen sind sie willkommen, in noch anderen wird ihre aktive Mitarbeit erwartet. Einige Schulen sind als Community Schools organisiert, in denen der Übergang von Schulleben und Familienleben fließend und die Schule eher Teil einer größeren Gemeinschaft ist, die zusammenlebt und teilweise auch ihre Erwerbsarbeit gemeinsam organisiert.
Mit Sicherheit wird es in einem pluralistischen System weiterhin diverse Alternativschulen geben, die nach unterschiedlichen reformpädagogischen Konzepten arbeiten und den Schülern Freiräume gewähren, die sie in traditionellen Schulen nicht haben. Einige dieser Schulen werden als festen Bestandteil ihres Konzepts besonderes Gewicht auf ökologische oder gesellschaftsverändernde Themen legen.
Es werden sich auch Schulen mit einer bestimmten politischen, weltanschaulichen oder religiösen Ausrichtung etablieren, so wie die bereits heute bestehenden Waldorf-Schulen.
Zuletzt ist auch weiterhin mit einem Spektrum traditioneller Schulen zu rechnen: Schulen, die wie jetzige Staatsschulen funktionieren, katholische Internate, autoritäre Eliteanstalten und dergleichen.
Auch die kritikwürdigsten Schulen kann es geben, solange sichergestellt werden kann, daß es die freie Entscheidung des Kindes bzw. Jugendlichen ist, sich dem auszusetzen. Dauerhaft wird es letztendlich nur Schulen geben, die den Schülern auch gefallen, sonst würden diese ja nicht mehr hingehen und jene Schulen würden schließen.
Weitere Bildungsmöglichkeiten
Reisen
Schulen sind bei weitem nicht die einzigen Möglichkeiten, zu Bildung zu kommen. Eine meist aufregende Variante ist Verreisen. Fahrten kann es aus ganz verschiedenen Anlässen und mit ganz verschiedenen Zielstellungen geben. Man kann sowohl zu einer Computermesse fahren, als auch Vulkane und Geysire in Island kennenlernen, Ausgrabungsstätten besuchen, Bergsteigen, mit anderen Kulturen zu tun haben und Fremdsprachen sprechen, z.B. wenn man in Gastfamilien wohnt. Solche Fahrten können sich auf ein bestimmtes Thema konzentrieren oder auf mehrere Themen oder auf gar keines. Einfach Spaß zu haben und etwas zu unternehmen, ist auch ein Motiv. Jedenfalls lernt man bei so einer Fahrt zahlreiche Sachen, die mit dem Leben zu tun haben.
Kongresse, Tagungen, Workshops und Seminare
Auch die Teilnahme an Kongressen, Tagungen, Workshops und Seminaren, die von den verschiedensten Vereinen und Organisationen zu allen möglichen Themen angeboten werden, stellt eine Form des Sich-bildens dar.
Arbeitserfahrungen
Grundsätzlich sollte jedes Bildungssystem den Anspruch haben, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, sich in der Erwachsenenwelt zurechtzufinden. Auf einen der wichtigsten Aspekte des Erwachsenenlebens, sollten sich junge Menschen besser als bisher vorbereiten können: auf das Erwerbsarbeiten. Dazu gehört nicht nur, ihnen das Wirtschaftssystem samt Ursachen und Folgen zu erklären, sondern auch, ihnen entsprechende praktische Erfahrungen zu ermöglichen. Junge Menschen sollten (natürlich auf freiwilliger Basis) Betriebspraktika machen, aber auch selbst unternehmerisch aktiv werden können. Bei all den Angelegenheiten, die beim Aufbau und Betrieb eines kleinen Unternehmens zu beachten sind, können junge Menschen viel lernen und Erfahrungen machen, die an Schulen bisher nicht möglich sind.
Medienangebote
Weitere Möglichkeiten für Bildungsangebote sind die verschiedenen Medien.
So gibt es schon seit langem (neben Nachrichtensendungen und Reportagen) Bildungsfernsehen und seriöse Wissensvermittlungssendungen. Diese Angebote sollten ggf. inhaltlich verbessert und thematisch ausgeweitet werden. Gesonderte Bildungskanäle können entstehen.
Besonders geeignet für Informationsbeschaffungen ist das Internet. Zu praktisch allen Themen findet man dort etwas. Als Ergänzung kann es noch ein umfassendes staatliches Online-Bildungsangebot geben. So können auch Informationen zu Themen angeboten werden, für die sich jeweils nur ein sehr kleiner Teil interessiert, so daß an kaum einer Schule ein Kurs dazu zustandekommt.
Ähnliches wie für das Internet gilt für Zeitschriften. Es könnte vom Bildungsministerium (oder in dessen Auftrag) herausgegebene Allgemeinbildungs- und Fachzeitschriften oder -magazine geben. Diese wären eine Alternative zu herkömmlichen Lehrbüchern, vor allem wären sie immer jeweils auf dem aktuellen Stand.
Homeschooling
Zu guter Letzt findet Lernen auch ohne staatliche Organisation und außerhalb von Bildungseinrichtungen statt. Das passiert auch jetzt schon am Nachmittag, am Wochenende und in den Ferien. Aber es gibt auch Kinder und Jugendliche, die überhaupt nicht zur Schule gehen, sondern ihre Bildung zuhause bekommen, was sich Homeschooling bzw. Home Education nennt. Da die in Deutschland geltende Schulpflicht Homeschooling nicht zuläßt, gibt es bundesweit nur ein paar Hundert Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter, die ohne Schule leben und lernen. In den USA hingegen sind es fast 2 Millionen.
Homeschooling muß für die Kinder jedoch nicht immer mehr Freiheit bedeuten als eine gewöhnliche Schule. Denn was sich hinter dem Begriff Homeschooling verbirgt, ist höchst unterschiedlich. Vor allem christliche Fundamentalisten, denen die gewöhnlichen Schulen zu liberal (!) sind, bringen ihre Kinder so rund um die Uhr unter ihre Kontrolle, so daß sie z.B. statt der Evolutionstheorie Schöpfungsgeschichte und Gottesfürchtigkeit gelehrt werden. Außerdem ist die Familie für den radikalen Christen der Mittelpunkt der Welt. Küche, Kirche, Kinder ...
Viele Homeschooling-Eltern wollen einfach individueller auf ihre Kinder eingehen, ohne jedoch die gewöhnlichen Schulen grundlegend in Frage zu stellen. Oder sie haben Angst, daß ihre Kinder in der Schule Opfer von Gewalttaten bzw. vielleicht durch ihre Mitschüler „negativ beeinflußt“ werden. Und so werden auch dort die Kinder einfach zu Hause von Eltern oder Verwandten nach mehr oder weniger traditionellen Lehrplänen unterrichtet.
Aber es gibt auch jene, die sehen, welchen Schaden die traditionellen Schulen bei Kindern anrichten, und die den Kindern deshalb zuhause eine freiere Umgebung bieten wollen. Feste Lehrpläne kommen da eigentlich nicht vor. Allerdings haben die Kinder auch in diesen Familien – ähnlich wie in reformpädagogisch orientierten Alternativschulen – nicht die volle Entscheidungsbefugnis über ihr Lernen.
Eine Sonderform des Homeschooling (oder in diesem Fall besser: der Home Education) ist das Unschooling. Unschooling ist vom Kind geleitetes Lernen in einer Wohnumgebung, statt die Schule und ihre Lehrpläne einfach zuhause nachzuahmen. Es gibt also auch keinen geplanten Unterricht oder bestimmte Zeiten am Tag, für die schulähnliche Aktivitäten vorgeschrieben sind. Themen werden behandelt, wenn das Interesse des Kindes es verlangt, nicht wenn Bildungsexperten behaupten, daß es Zeit wäre, ein Thema zu kennen. Die Eltern – oder die Personen, mit denen das Kind zusammenlebt – verfolgen nicht wie die anderen Homeschooler einen Plan, den sie „notfalls“ auch gegen den Willen des Kindes durchsetzen würden. Unschooling-Kinder lernen ähnlich wie Schüler an Sudbury-Schulen aus dem Leben heraus, haben im Gegensatz zu ihnen allerdings nicht die Möglichkeit eines demokratischen und rechtsstaatlichen Systems.
Auch wenn Homeschooler und Unschooler nicht so automatisch mit anderen Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen wie Kinder, die zur Schule gehen, sind die sozialen Kontakte in der Regel doch recht ausgeprägt. Oft schließen sich Homeschooling-Familien zusammen und organisieren gemeinsame Aktivitäten. Mancherorts gibt es auch Resource Centers, die ihnen zur Nutzung offenstehen.
Homeschooling muß in einer freien Bildungslandschaft prinzipiell möglich sein. Hier zeigt sich aber auch, wie wichtig es ist, daß nicht die Eltern, sondern die Kinder das Recht bekommen zu entscheiden, was und auf welche Weise sie lernen. Es muß sichergestellt werden können, daß niemand zum Unterricht gezwungen wird.
Viele Sachen lernt man tatsächlich in Alltagssituationen und ohne, daß man sie konkret vorhersehen könnte. Und wenn man sich anguckt, wieviel man von dem, was einem die Zwangsschulen beizubringen versuchen, letztendlich wieder vergißt, stellt man fest, daß man gerade auch heutzutage das meiste außerhalb der Schule lernt.
Es ist anzunehmen, daß die wenigsten Kinder oder Jugendlichen ausschließlich eine der genannten Möglichkeiten nutzen werden. Selbstverständlich können die verschiedenen außerschulischen Bildungsformen in die oben beschriebenen demokratischen Staatsschulen eingebaut bzw. durch sie unterstützt werden.
Damit wären die konkreten Bildungsmöglichkeiten im Überblick dargestellt.
Recht auf selbstbestimmte Bildung durchsetzen
Problemstellung
Eine der wichtigsten Fragen in einem freiheitlich-demokratischen Bildungssystem ist, wie das Recht des Kindes auf selbstbestimmte Bildung durchgesetzt werden kann.
Im derzeitigen Schulsystem wird davon ausgegangen, daß das Recht auf Bildung und die Schulpflicht zwei Seiten einer Medaille sind. Wer in der Schule anwesend ist, dessen Recht auf Bildung gilt als gesichert; und wer nicht anwesend ist, dessen Bildungsrecht werde verletzt. Allerdings handelt es sich beim geltenden Recht auch nicht um ein Recht auf selbstbestimmte Bildung, sondern nur um eines auf fremdbestimmte.
In einem freiheitlich-demokratischen Bildungssystem gibt es keine Schulpflicht mehr, und das Recht auf Bildung beinhaltet ebenso das Recht, den Schulbesuch zu verweigern bzw. sich Wissen auf andere Weise zu beschaffen. Somit läßt sich nicht ohne weiteres feststellen, wann eine Verletzung des Rechts auf Bildung vorliegt. Das macht die Durchsetzung dieses Rechts wesentlich komplizierter.
Im Gesetz muß eindeutig festgelegt sein, daß das Recht auf Bildung ein Recht des Kindes ist und nicht ein Recht der Eltern. Ähnlich wie es das Strafgesetzbuch jedem verbietet, einen Wahlberechtigten vom Wählen abzuhalten oder ihn zu zwingen, eine bestimmte Partei zu wählen, so kann auch Eltern, Verwandten und Bekannten verboten werden, das Kind durch Drohungen oder gezielte Falschinformationen vom Besuch einer Bildungseinrichtung abzuhalten oder ihm vorschreiben zu wollen, welche Angebote es anzunehmen hat.
Gleichzeitig kann aber vor allem von jüngeren Kindern nicht verlangt werden, daß sie sich selbst um die Anmeldung bei einer Schule kümmern. Daher können wir uns die nachfolgend beschriebene Lösung vorstellen.
Automatische Einschulung in Demokratische Schulen
Da wir annehmen, daß Kinder neugierig sind und lernen wollen, ohne dabei jedoch zum Lernen gezwungen zu werden, stellt sich die Frage, wie dies am besten für alle Kinder erreicht werden kann.
Prinzipiell können Kinder auch ohne die Institution Schule lernen. Das setzt aber zumindest bei kleineren Kindern voraus, daß die Eltern Bildungsmöglichkeiten bereitstellen und auf Bedürfnisse der Kinder eingehen. Da ein erheblicher Teil der Eltern sich jedoch nicht um die Bildungsbedürfnisse ihrer Kinder kümmern möchte, oder die Kinder möglicherweise sogar vernachlässigt, wären dadurch für viele Kinder die Bildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten recht eingeschränkt.
Demokratische Schulen mit Kursangebot hingegen bieten Kindern und Jugendlichen jeden Alters eine anregende Bildungsumgebung, in der sie frei und selbstbestimmt lernen können, was, wann und wie sie wollen. Insbesondere für Kinder, deren Eltern sich nicht kümmern, ist die reale Entscheidungsfreiheit in einer Demokratischen Schule weitaus größer als beim Aufwachsen ohne Schule.
Da eine Demokratische Schule das Recht auf Bildung also besser sichern kann, sollen Kinder mit 5 oder 6 Jahren standardmäßig in eine Demokratische Schule eingeschult werden. Wenn das Kind sich mit seinen Eltern auf andere Bildungsformen einigt, sind diese natürlich ohne weiteres möglich. Aber dies setzt dann voraus, daß Eltern oder andere Bezugspersonen des Kindes sich Gedanken machen und sich kümmern sowie daß das Kind dem Alternativprogramm zustimmt. Wenn Eltern sich nicht kümmern oder sich mit dem Kind nicht einigen können, kommt das Kind auf eine Demokratische Schule und kann dort in Freiheit spielen und lernen.
Natürlich ist es möglich, später die Schule zu wechseln oder dann doch ohne Schule zu lernen.
Außerdem soll das Kind jederzeit die Möglichkeit haben, wieder in eine Demokratische Schule zurückzukehren. Meldet es sich von der Demokratischen Schule ab, ruht die Mitgliedschaft nur. Um zurückzukehren, muß das Kind einfach nur wieder regelmäßig in der Demokratischen Schule erscheinen. Die Formalitäten erledigt ein Amt für freie Wahl der Bildung (siehe unten).
Diese Regelung ist zwar eine Bevorzugung der Demokratischen Schulen, andernfalls würde aber entweder eine nicht demokratische Schulform oder das Aufwachsen ohne Schule bevorzugt werden. Dadurch würden Kinder „bildungsferner“ Eltern zusätzlich benachteiligt.
Das Modell der Schulregelungs-Berechtigung
Für die Abmeldung von der Schule bzw. einem Bildungsprogramm bzw. den Wechsel auf eine andere als die Demokratische Schule ist zunächst sowohl die Zustimmung des Kindes als auch die seiner Eltern (Sorgeberechtigten) notwendig. Dazu sind Kinder und Eltern mit einer Schulregelungs-Berechtigung ausgestattet.
Somit muß die Initiative nicht vom Kind ausgehen, sondern Eltern können sich auch von sich aus um die Anmeldung bei einer Schule kümmern. Eltern dürfen von der Schulregelungs-Berechtigung allerdings nur treuhänderisch, d.h. im Interesse des Kindes, Gebrauch machen.
Wenn das Kind mit der Auswahl der Eltern einverstanden ist, wird es so gemacht. Wenn das Kind bzw. der Jugendliche jedoch nicht einverstanden ist, weil es z.B. in ein autoritäres Internat gesteckt werden soll, können die Eltern nichts machen, da die Anmeldung nur gültig wird, wenn auch das Kind zustimmt.
Andererseits können Kinder und Jugendliche sich zwar selbst um eine Schule oder um sonstige Angebote kümmern, benötigen aber ebenfalls erst mal das Einverständnis ihrer Eltern. Dadurch sollen unbedachte spontane Entscheidungen vermieden und fundierte Entscheidungen gefördert werden.
Nun kann es aber dazu kommen, daß Eltern durch die Verweigerung ihrer Zustimmung ihre Kinder von selbstbestimmten Bildungswegen abhalten wollen. Da es jedoch darum gehen soll, daß Kinder und Jugendliche ihr Recht auf Bildung notfalls auch gegenüber den Eltern durchsetzen können, müssen sie die Möglichkeit haben, den Eltern bzw. einem der Elternteile die Schulregelungs-Berechtigung wieder zu entziehen.
Die Kinder bzw. Jugendlichen können die Schulregelungs-Berechtigung auch auf (beliebig viele) andere Verwandte, Mitbewohner oder sonstige Menschen ihres Vertrauens übertragen. Damit können dann auch diese Menschen dem Kind bei der Suche nach und Anmeldung zu einem Bildungsprogramm helfen bzw. die Initiative dazu ergreifen. Allerdings müssen dann auch immer all diese Personen Entscheidungen über z.B. einen Schulwechsel mittragen.
Das Schulregelungs-Berechtigungs-Modell bietet den Kindern einen gewissen Schutz vor Eltern, die Druck ausüben. Denn die Eltern wissen nicht, ob es weitere Schulregelungs-Berechtigte gibt. So kann das Kind behaupten, daß ein anderer Berechtigter seine Zustimmung nicht gegeben hat, auch wenn nur es selbst nicht nachgeben will. Die Möglichkeit, Schulregelungs-Berechtigte zu umgehen (siehe unten), setzt dem allerdings Grenzen.
Kinder und Jugendliche können aber auch Alleininhaber der Schulregelungs-Berechtigung werden, wenn sie sie ihren Eltern entziehen und niemand anderem erteilen. In diesem Fall erhält der jeweilige junge Mensch eine ausführliche Einweisung in alle relevanten Schul-, Rechts- und Verwaltungsfragen, damit er sich dann allein zurecht finden kann.
Das Amt für freie Wahl der Bildung (AfWB)
Das Entziehen und Erteilen der Schulregelungs-Berechtigungen erledigen die Kinder bei einer öffentlichen Stelle – dem „Amt für freie Wahl der Bildung“ (AfWB). Dort kann sich jeder Mensch – egal ob Kind, Eltern, sonstiger Schulregelungs-Berechtigter oder einfach interessierter Bürger – sowohl durch ausliegende Infomaterialien als auch im persönlichen Gespräch mit Mitarbeitern über die bestehenden Bildungsangebote und sonstigen Aspekte des Bildungswesens ausführlich informieren.
Wenn die Eltern (gemeint sind im folgenden jeweils auch die möglichen anderen Schulregelungs-Berechtigten) sich überlegt haben, auf welche Art ihr Kind sich künftig bilden soll, sind die Mitarbeiter des Amts auch bei der Anmeldung an einer Schule oder einem sonstigem Programm behilflich, jedoch grundsätzlich nur nach Absprache mit dem betroffenen Kind bzw. Jugendlichen.
Vor allem aber können sich Kinder und Jugendliche, die eigene Vorstellungen über ihren Bildungsweg haben, selbst an das AfWB wenden, um sich bei den mit der Anmeldung an einer Bildungseinrichtung verbundenen Formalitäten helfen zu lassen. Der jeweilige Mitarbeiter informiert das Kind über seine Rechte im Bildungswesen, bespricht mit ihm alle Schritte des Anmeldeverfahrens und weist das Kind auf mögliche Folgen dessen Handelns hin. Selbst wenn der Mitarbeiter persönlich Bedenken haben mag, kann er Entscheidungen aber nicht verhindern, da er ja den Kindern und Jugendlichen gerade dabei helfen soll, ihr Recht auf Bildung durchzusetzen. Wenn die Schulregelungs-Berechtigten nun zustimmen, ist die Anmeldung ohne Komplikationen zustande gekommen.
Sich gegen Eltern durchsetzen
Egal ob ein Kind oder Jugendlicher sich mit Hilfe des Amts für freie Wahl der Bildung oder ganz allein bei einer Bildungseinrichtung anmelden will, kann der Fall eintreten, daß der junge Mensch nicht die Zustimmung seiner Eltern erhält, weil diese den gewünschten Bildungsweg entweder direkt ablehnen oder es dauerhaft unterlassen, sich mit dem Anliegen ihres Kindes zu befassen. Wenn das Kind ihnen die Schulregelungs-Berechtigung aber dennoch nicht prinzipiell entziehen will, sondern nur in diesem Einzelfall seinen Anspruch auf selbstbestimmte Bildung durchsetzen will, kann es das mit Hilfe des AfWB tun.
Sofern sich das Kind ursprünglich ohne Hilfe durch das AfWB bei einer Bildungseinrichtung anmelden wollte, findet zunächst ein Informations- und Beratungsgespräch zwischen dem Kind und Mitarbeitern dieses Amtes statt. Dadurch soll sichergestellt werden, daß junge Menschen ihre Entscheidungen möglichst wohldurchdacht und im Wissen um eventuelle Risiken treffen.
Wenn das Kind sich nun sicher ist, mit Hilfe des AfWB die Anmeldung durchsetzen zu wollen, schickt das AfWB den Eltern (oder wer gerade über eine Schulregelungs-Berechtigung verfügt) einen Brief, in dem sie über das Vorhaben des Kindes offiziell informiert werden und Gelegenheit erhalten, sich innerhalb einer bestimmten Frist dazu zu äußern.
Auf der Grundlage der Antwort der Eltern findet ein weiteres Beratungsgespräch statt. Wenn sich das Kind dann seiner Sache nach wie vor sicher ist, führt das AfWB die Anmeldung bei der gewünschten Einrichtung im Auftrag des Kindes durch und informiert die Eltern darüber, die nun erfolgreich umgangen worden sind. Das Kind hat sein Recht auf selbstbestimmte Bildung durchgesetzt.
Sich gegen die eigenen Eltern durchzusetzen, wäre für viele Kinder vermutlich eine starke psychische Belastung und daher keine leichte Angelegenheit. Deshalb ist es aber gerade wichtig, daß im Konfliktfall das Recht auf Seiten der Kinder ist und nicht gegen sie. Jugendlichen wird es wahrscheinlich leichter als Kindern fallen, ihr Recht auch gegen die eigenen Eltern durchzusetzen.
Sonderfall Homeschooling
Das Homeschooling nimmt unter den Bildungsmöglichkeiten eine Sonderrolle ein. Den am Homeschooling beteiligten Erwachsenen gegenüber (meist sind es die Eltern) kann das Kind keinen Anspruch auf Homeschooling haben. Ein solcher Anspruch wäre eine Einschränkung ihrer Berufsfreiheit. Es muß die Entscheidung der Erwachsenen sein, ob und welche Art von Homeschooling sie anbieten. Für den Fall, daß sie ein bisheriges Angebot nicht weiter aufrechterhalten wollen, muß sollte es aber eine Art Kündigungsfrist geben.
Kinder und Jugendliche haben allerdings einen Anspruch auf Unterlassung, also das Recht, nicht vorgeschrieben zu bekommen, womit sie sich zu beschäftigen oder was und auf welche Weise sie zu lernen haben.
Betreuungsproblem
Sowohl Schule als auch Homeschooling sind nicht nur Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, sich zu bilden, sondern haben im Normalfall auch eine Betreuungsfunktion. Der Umstand, daß das Kind keinen Anspruch auf Homeschooling hat, führt mitunter schlagartig zu einem Problem: Das Modell der Schulregelungs-Berechtigung besagt, daß Entscheidungen über den weiteren Bildungsweg stets der Zustimmung des Kindes bzw. Jugendlichen bedürfen. Wenn Eltern Homeschooling nicht länger anbieten (oder auch wenn die bisherige Schule des Kindes ihren Betrieb einstellt), steht allerdings bereits fest, daß sich der betreffende junge Mensch künftig an einem anderen Ort bilden muß. Es ist jedoch vorstellbar, daß er keiner der denkbaren Bildungsmöglichkeiten zustimmt. Es stellt sich die Frage, wie es zum einen mit der Bildung und zum anderen mit der Betreuung weitergeht.
Der Bildungsaspekt bereitet im Grunde kein allzu großes Problem. Das Kind ist nicht verpflichtet, einem bestimmten Bildungsweg zu folgen. Wenn es jedes mögliche Angebot ablehnt, ist das als Entscheidung zu akzeptieren. Etwas lernen kann das Kind auch ohne institutionellen Rahmen. In jedem Fall stehen ihm die staatlichen Demokratischen Schulen offen.
Aber kann das Kind auch selbst entscheiden, auf Betreuung zu verzichten? Stellen wir uns die Problemlage anhand folgender Situation vor: Ein Kind hat bisher seinen Tag zu Hause bei seinen Eltern verbracht und ist auch ganz zufrieden damit. Nun entschließen sich die Eltern jedoch, arbeiten zu gehen. Das Kind braucht einen neuen Aufenthaltsort. Es könnte auf eine Schule gehen. Aber vielleicht gefällt ihm keine der Schulen. Das Kind könnte seine Zeit tagsüber bei den Großeltern oder anderen Verwandten verbringen. Aber vielleicht wohnen die in einem ganz anderen Ort, oder sie haben keine Lust dazu, oder das Kind will mit ihnen nichts zu tun haben. Das Kind könnte bei Nachbarn oder Eltern von Freunden bleiben, aber vielleicht geht auch das nicht. Wenn das Kind schon älter ist und die Eltern keine Bedenken haben, könnte es auch tagsüber allein in ihrer Wohnung sein bzw. draußen etwas unternehmen, Freunde treffen etc. Aber vielleicht ist das Kind erst 7 Jahre alt. Egal, welche Möglichkeit man dem Kind anbietet, es kann immer sein, daß es nicht einverstanden ist. Es muß aber eine Entscheidung getroffen werden, weil die (bisherige) Variante des Zuhause-bleibens nicht (mehr) zur Verfügung steht.
Daß die Versorgung mit Bildungsmöglichkeiten und die Betreuung zwei verschiedene Fragestellungen sind, wird auch deutlich, wenn man bedenkt, daß es Bildungsangebote geben kann, die nur während des Nachmittags oder am Abend stattfinden. Auch Homeschooling können berufstätige Eltern abends bzw. am Wochenende mit ihren Kindern praktizieren. Die Betreuung der Kinder werktags Vormittag ist damit nicht gelöst.
Die Betreuungsproblematik an sich ist auch in der heutigen Zeit bekannt. So gehen Kinder in den Ferien nicht zur Schule, während die berufstätigen Eltern weiterhin arbeiten gehen. Oder: Der Schulunterricht ist bereits vorbei, während eine mit ihren Kindern allein lebende Mutter am Nachmittag noch arbeiten muß. Heutzutage muß bei Betreuungsfragen jedoch keine Rücksicht auf die Interessen des Kindes genommen werden, sondern Eltern können das Kind einfach irgendwo abgeben.
Wenn man ein weitgefaßtes Bildungsverständnis zugrunde legt, kann man sich bezüglich der Betreuungsfrage nicht einfach für unzuständig erklären. Denn auch Betreuungseinrichtungen haben in der Regel ein pädagogisches Konzept und versuchen, Bildung zu vermitteln. Dem müssen Kinder und Jugendliche sich entziehen können, wenn an dieser Stelle ihr Recht, ihre Bildung selbst zu bestimmen, nicht untergraben werden soll. Eine Möglichkeit wären auch hier wieder die staatlichen Demokratischen Schulen, da Kinder und Jugendliche dort vor pädagogischen Interventionen weitgehend sicher sind. Andererseits wäre es auch problematisch, wenn junge Menschen dort ggf. gegen ihren Willen hingehen müßten. Auf die Frage, wie im Konfliktfall die Betreuung geregelt werden soll, muß also noch eine überzeugende Antwort gefunden werden.
Aufklärung und Informationspflicht
Das praktische Funktionieren dieses ganzen Schulregelungs-Berechtigungs-Prinzips setzt eine gewisse Informiertheit sowohl seitens der Kinder und Jugendlichen als auch seitens der beteiligten Erwachsenen über die Entscheidungskompetenzen etc. voraus.
So müßten Eltern, wenn sie ihr Kind bei einer Schule oder einem sonstigen Programm anmelden wollen, nicht nur um die letztendliche Zustimmung des Kindes bitten, sondern es vorher auch über alle wichtigen Aspekte der betreffenden Einrichtung informieren. Dazu gehören, wie ein Tagesablauf dort aussieht, ob bzw. welche vorgeschriebenen Aktivitäten es gibt und in welchen Bereichen der Schüler selbst entscheiden darf, wie dort Regeln zustande kommen und wie sie geändert werden können bzw. allgemein welche Mitbestimmungsmöglichkeiten bestehen, ob bzw. wie Schüler dort bewertet werden, welche Rolle die Lehrer/Mitarbeiter spielen, welche Ausstattung zur Verfügung steht, welche Kurse stattfinden, etc. Die Zustimmung des Kindes soll mehr als nur ein Abnicken sein. Sie soll Ergebnis eines echten Dialogs zwischen Eltern und Kind sein.
Eine weitere Möglichkeit, diese Informiertheit zu erreichen, wäre, jede Schule zu verpflichten, jedem an der Anmeldung interessierten Schüler und seinen Schulregelungs-Berechtigten in einem Informationsgespräch die oben aufgezählten Eigenschaften der Schule darzulegen. Außerdem könnte festgelegt werden, daß die eigentliche Anmeldung bei einer Schule erst nach Absolvierung einer Probewoche möglich ist, in der der Schüler herausfinden kann, ob er diese Schule tatsächlich künftig besuchen möchte. Wenn nötig, kann der Probebesuch auch länger als eine Woche dauern.
Darüber hinaus wären Eltern verpflichtet, die Kinder über ihre Möglichkeiten im Bildungssystem zu informieren, insbesondere darüber, daß die Kinder die Vorschläge der Eltern nicht annehmen müssen.
Nun besteht aber die Möglichkeit, daß die Eltern selbst schlecht informiert sind. In einem System mit starrer Schulpflicht ist das relativ egal, weil sowohl Eltern als auch Kinder kaum etwas zu entscheiden haben. In einem System mit vielen verschiedenen Bildungsmöglichkeiten, in dem auch die Eltern bedeutenden Einfluß haben, ist das anders. So befürchten einige, daß vor allem Eltern, denen „Bildung“ nicht wichtig ist, von sich aus wenig auf die Interessen der Kinder achten werden bzw. daß die Kinder kaum Zugang zu Bildungsmöglichkeiten haben werden. Wie die Erfahrungen aus z.B. den USA oder Dänemark zeigen, schicken solche Eltern ihre Kinder normalerweise auf gewöhnliche traditionelle Staatsschulen. Nach herkömmlichem Bildungsverständnis wäre damit eine angemessene Bildung für die Kinder gesichert. Bedenkt man jedoch – vor dem Hintergrund dessen, was wir über das Lernen wissen –, was die Schüler von dem dort gelehrten tatsächlich behalten, sieht die Sache schon wieder anders aus. Bildung und Lebenserfahrung hängen weniger von traditioneller Schulbildung als von den Betätigungsmöglichkeiten und der Entscheidungsfreiheit der Kinder ab.
Daß die Interessen des Kindes übergangen werden, ist vor allem im gegenwärtigen deutschen Zwangsschulsystem etwas alltägliches, aber auch in jenen Ländern, in denen allein die Eltern über den Schulbesuch entscheiden. Von allen bekannten Modellen garantiert das hier vorgeschlagene Schulregelungs-Berechtigungs-Modell in Verbindung mit der automatischen Einschulung in eine staatliche Demokratische Schule die größte Entscheidungsfreiheit für Kinder und Jugendliche.
Um die Risiken, die von einer allgemeinen Uninformiertheit ausgehen, gering zu halten, betreibt das Amt für freie Wahl der Bildung umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehören Rundschreiben an alle Eltern und Kinder, in denen die Befugnisse der Eltern, der Kinder und des AfWB verständlich erklärt werden. Dazu kommen Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften, Werbung auf großformatigen Plakatwänden im öffentlichen Raum und TV-Spots, ausliegende Infos bei Ärzten, in Bibliotheken, Ämtern und anderen öffentlichen Gebäuden.
Um die Kinder zusätzlich anzusprechen, könnten zwischen von Kindern gesehenen Fernsehsendungen (analog zur Spielzeugwerbung) kurze auf die jeweilige Altersgruppe abgestimmte Info-Beiträge gesendet werden. Wenn Kinder bei außerschulischen Aktivitäten auf andere Kinder treffen, werden sie sich wohl auch untereinander über ihre Schulerfahrungen austauschen.
Im übrigen werden rechtzeitig vor der Einführung des Schulregelungs-Mandats-Modells die Medien wohl ausführlich darüber berichten. Die Freiheit der Kinder im Bildungswesen wird überall Gesprächsthema sein.
Darüber hinaus könnten alle Eltern und Kinder verpflichtet werden, einmal im Jahr einen Berater des Amts für freie Wahl der Bildung aufzusuchen – nicht aus Mißtrauen den Kindern gegenüber, sondern zur Vermeidung von Unwissenheit bzw. Machtmißbrauch seitens der Eltern.
Jedenfalls dürfte es dann nicht mehr vorkommen, daß Eltern nichts davon wissen, daß ihr Kind ein unverletzliches Recht auf Bildung hat. Und auch die Kinder werden dann wissen, daß sie über ihre Bildung selbst entscheiden dürfen.
Beschwerdemöglichkeit
Grundsätzlich hätten alle Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, sich über Übergriffe ihrer Eltern beim Amt für freie Wahl der Bildung zu beschweren. Zu den Übergriffen zählen z.B. Drohungen, Erpressung, bewußte Falschinformation oder auch ein gegen den Willen des Kindes durchgezogenes Homeschooling-Programm. So wie die derzeitigen Schul- und Schulpflichtgesetze – in der Annahme, jeder Verstoß gegen die Schulpflicht verletze das Recht auf Bildung – Bußgelder gegen Eltern vorsehen, können auch in einem freiheitlichen Bildungssystem bei Mißachtung des Rechts auf selbstbestimmte Bildung Bußgelder verhängt werden. Die Eltern dürften sich dann auch dessen bewußt sein, daß Übergriffe auch später noch vom Kind selbst aufgedeckt werden können.
Es wird letztendlich schwer sein, einem informierten Kind sein Recht auf selbstbestimmte Bildung vorzuenthalten, da es sich ja notfalls auch ohne Hilfe der Eltern an einer Bildungseinrichtung anmelden kann. Wahrscheinlich wird sich aber schon allein durch die Einführung des Bildungsrechtes als tatsächlichem Recht des Kindes die Sichtweise auf Kinder so ändern, daß immer weniger Eltern überhaupt auf die Idee kommen Kindern dieses Recht vorzuenthalten.
Organisatorische Fragen
Schulabschlüsse
Wenn es keine Zensuren gibt, stellt sich die Frage nach den Schulabschlüssen. Heutzutage sind Schulabschlüsse sowohl bedeutsam, wenn es um Bewerbungen um Arbeitsplätze geht, als auch wenn es um den Zugang zur Universität geht.
Schulabschlüsse spiegeln – und auch das nur im Idealfall – einen abrufbaren Wissensstand zum Ende der Schullaufbahn wieder. Damit verlieren sie im Laufe der Zeit aber immer mehr an Aussagekraft, da Wissen von damals bereits in Vergessenheit geraten sein kann und neu erworbenes Wissen unberücksichtigt bleibt. Ein pauschaler Schulabschluß sagt kaum etwas darüber aus, ob man bestimmtes Wissen bzw. bestimmte Fähigkeiten hat. Genauso wenig sagt das Fehlen eines konkreten Schulabschlusses aus.
Eine Alternative zu Schulabschlüssen und Abschlußprüfungen wären Aufnahmeprüfungen. Mit diesen können auch Arbeitgeber besser herausfinden, ob das tatsächlich benötigte Wissen für eine bestimmte Angelegenheit vorhanden ist. Aufnahme-, Zugangs- oder Eignungsprüfungen sind immer aktueller und bedarfsgerechter als Schulzeugnisse. Schon heute spielt das Zeugnis in den Augen vieler Chefs kaum noch eine Rolle.
Und auch für ein normales Universitätsstudium macht das Abitur als Bedingung kaum einen Sinn. Jemand, der nicht weiß, wie man die Fläche unter dem Graphen einer Cosinus-Funktion berechnet, ist doch nicht automatisch unfähig zu studieren. Statt des Abiturs sollte es nach Studienrichtungen differenzierte Zugangsprüfungen geben. Durch diese Zugangsprüfungen sollen nur wichtige Grundlagen garantiert werden. Über die Zugangsbedingungen müssen sich Interessierte ohne großen Aufwand informieren können (wie auch bei den staatlichen Demokratischen Schulen mit Kursangebot). Wenn sich jemand selbst überschätzt und mit dem Studium nicht klarkommt, kann er ja immer noch damit aufhören. Durch diese Art der Regelung könnten Menschen unabhängig von Schulabschlüssen studieren.
Da nicht davon auszugehen ist, daß diese Regelung in allen Bundesländern gleichzeitig eingeführt wird, muß es Übergangsregeln geben. Wer in einem anderen Bundesland studieren will, wird dazu also vorerst weiterhin das Abitur brauchen. Daher wird es zumindest im Rahmen der Demokratischen Schulen mit Kursangebot möglich sein, das Abitur und andere Schulabschlüsse zu erwerben. Da jeder selbst entscheidet, welche Schulveranstaltungen er besucht, muß das Verfahren für den Erwerb von Abschlüssen entsprechend flexibel gestaltet werden. Naheliegend wäre eine Orientierung an Universitäten: Um einen Abschluß zu bekommen, muß man Leistungsnachweise (sogenannte „Scheine“) vorlegen, für die man bestimmte Veranstaltungen (Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlveranstaltungen) erfolgreich besuchen und möglicherweise auch Prüfungen bestehen muß. Wann, in welcher Reihenfolge und über welchen Zeitraum man dies tut, bleibt einem selbst überlassen. Welche Anforderungen erfüllt werden müssen, damit das Abitur in allen anderen Bundesländern anerkannt wird, hängt letztendlich auch von diesen anderen Bundesländern ab.
Durchlässigkeit
Des weiteren stellt sich die Frage der Durchlässigkeit, also inwieweit es möglich ist, von einem Schultyp auf einen anderen zu wechseln. Wie schon oben beschrieben, ist ja ohnehin eine enge Kooperation der beiden Staatsschultypen vorgesehen. Daher sind sie in sehr hohem Maße durchlässig. Schüler, die von einer nicht-staatlichen Bildungseinrichtung kommen, können sich ebenfalls in die staatlichen Schulen integrieren, da keine prinzipiellen Voraussetzungen seitens der Schüler erfüllt werden müssen. Inwieweit es Probleme gibt, wenn Schüler von staatlichen auf private Schulen wechseln wollen, hängt im wesentlichen von den Kriterien der privaten Schulen ab. Wenn solch ein Wechsel etwas langfristiger geplant wird, hat der Schüler genügend Zeit, um sich auf die Anforderungen seiner zukünftigen Schule, also z.B. das Bestehen einer Aufnahmeprüfung, vorzubereiten.
Ländliche Gegenden
In ländlichen Gegenden ist die Auswahl wegen der geringen Besiedlungsdichte geringer als in Städten. Wenn sich der Trend zu kleinen Schulen bestätigt, besteht aber auch auf dem Land eine Chance für Vielfalt. Schlimmer als bisher wird es zumindest nicht werden. Um die strukturellen Nachteile von Dorfschulen zu vermindern, könnte das jeweilige Bundesland besondere Zuschüsse oder Zusatzförderungen vergeben. Außerdem könnte ein Finanzausgleich zwischen den unterschiedlichen Regionen eingerichtet werden.
Ferienzeiten
An den Ferienzeiten muß eigentlich nicht viel geändert werden. Sie erhalten aber mehr den Charakter von Empfehlungen, um z.B. den Urlaub besser planen zu können. Man kann darüber nachdenken, ob die Sommerferien auf zwei Monate ausgeweitet werden sollten, die Winterferien nicht Anfang sondern Mitte Februar beginnen und ob es auch in Berlin Pfingstferien geben sollte. Man könnte noch überlegen, wie man mit der Tatsache umgeht, daß mehrere Ferien an christlichen Festen orientiert sind, aber ein Teil der Schüler z.B. moslemischen oder jüdischen Glaubens ist. Die Ferienzeiten sind ohnehin nur in den Staatsschulen mit Kursangebot und einem Teil der nicht-staatlichen Schulen von Bedeutung.
Überschulische Interessenvertretung
Neben der Mitbestimmung innerhalb der jeweiligen Schule ist die demokratische Beeinflussung des Bildungssystems auch auf höherer Ebene vorzusehen. Üblicherweise sind dies die kommunale und die Landesebene. Die kommunale Ebene muß dabei nicht den Kommunen, Landkreisen oder Stadtbezirken entsprechen, wenn deren Größe nicht sinnvoll erscheint. In Berlin z.B. könnte sich diese kommunale Ebene an den Landtagswahlkreisen orientieren, die ca. 6 000 Schüler umfassen.
Anders als bisher würden die Vertretungen direkt von den Schülern gewählt. Schüler mit ähnlichen Vorstellungen schließen sich in Listen zusammen. Gewählt wird nach dem Verhältniswahlrecht. Die Vertretungen bestehen aus ca. 20 Schülern. Mitglieder der Landesschülervertretung müssen nicht, wie in Berlin lange Zeit üblich, gleichzeitig auch Mitglieder der kommunalen Schülervertretung sein. Damit die Schüler auch wissen, welches Programm sie wählen, erhalten die Kandidaten umfassend die Möglichkeit, sich und ihre Ideen vorzustellen.
Die Vertretungen sind verpflichtet, Informationen (auch über ihre Arbeit) an die einzelnen Schulen weiterzugeben und sie allen Schülern zugänglich zu machen. Kommunale und Landesvertretung stehen in engem Kontakt und informieren sich gegenseitig. Für ihre Arbeit ist den Schülervertretungen genügend Geld zur Verfügung zu stellen.
Schulinterne Gremien und überschulische Schülervertretungen haben ein allgemeinpolitisches Mandat, d.h. sie dürfen sich auch zu allen Angelegenheiten äußern, die nicht bildungsspezifisch sind.
Wechselwirkungen mit der Gesellschaft
Das Bildungssystem ist natürlich nicht losgelöst von der Gesellschaft, sondern ein Bestandteil dieser. Deshalb stellt sich die Frage, welche Anforderungen ein freiheitlich-demokratisches Bildungssystem an die Gesellschaft stellt. Es ist offensichtlich, daß solch ein Bildungssystem am besten in eine ebenso freiheitlich-demokratische Gesellschaft paßt, die frei von Fremdbestimmung, Selektion und vermeidbarem Leistungsdruck ist. Aber auch in einer Gesellschaft, in der wirtschaftliche Verwertbarkeit und „Leistung“ von großer Bedeutung sind, kann solch ein Bildungssystem existieren. Die bereits heute existierenden Schulen nach dem Sudbury-Modell beweisen, daß freiheitliche Schulen dauerhaft in einem wirtschaftsliberalen Gesellschaftssystem existieren können und daß die Schüler dort sogar erfolgreicher als Schüler traditioneller Staatsschulen sind: 85% gehen auf die Uni oder andere Einrichtungen höherer Bildung; fast alle bekommen den gewünschten Beruf. Wenn Sudbury-Schulen derart erfolgreich sind, ist es naheliegend zu vermuten, daß die Demokratischen Schulen mit Kursangebot, die ja ebenfalls Freiheit und Verantwortung des Einzelnen als Grundlage haben, ähnlich erfolgreich sein werden.
Natürlich hat auch die Schule einen Einfluß auf gesellschaftliche Bedingungen. Es ist z.B. nicht unwahrscheinlich, daß eine Schule ohne Leistungsdruck zu Veränderungen auch in der Arbeitswelt führen wird. Eine von Grund auf demokratische Schule färbt auf die Gesellschaft ab. Die Kinder erfahren Demokratie als etwas für sie Sinnvolles und als etwas von Anfang an Selbstverständliches. Sie erleben, daß sie geachtet und akzeptiert werden und daß ihnen vertraut wird. Sie sind nicht eingeschüchtert, sondern selbstbewußt und selbstsicher. Die Kinder und Jugendlichen wissen, daß sie selbst für ihre Bildung verantwortlich sind. Und sie lernen, mit dieser Verantwortung umzugehen. Sie lernen allgemein, Verantwortung zu übernehmen. Sie befinden sich in einer natürlichen Umgebung von Toleranz, Friedfertigkeit und Gerechtigkeit. An heutigen Staatsschulen werden all diese Werte durch Erziehung zu vermitteln versucht – und der Erfolg ist gering, wie die allgegenwärtigen Kampagnen und immer wieder neuen Initiativen zur ”Werte-Erziehung” beweisen. In einem freiheitlich-demokratischen Bildungssystem brauchen die obengenannten Werte nicht künstlich vermittelt werden, sie sind einfach erlebbar.
Wer diese Werte von Anfang an als etwas Positives und Selbstverständliches erlebt, wird sie später auch mit größerer Wahrscheinlichkeit verteidigen. Dies wird sich auch auf den Umgang mit Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft auswirken. Auch in anderen Gesellschaftsbereichen sowie in den Familien wird die Subjektstellung des Kindes anerkannt werden. Sehr wahrscheinlich wird auch der Umgang mit Ausländern und behinderten Menschen, die von diesem Schulsystem selbstverständlich nicht ausgegrenzt werden, würdiger und menschlicher werden. Außerdem ist davon auszugehen, daß sich friedliche Konfliktlösungsmechanismen stärker durchsetzen werden. Das alles wird sicher nicht sofort geschehen, aber sich im Laufe der Zeit entwickeln.
Als längerfristige Folge wird ein derart freies Bildungssystem zu einer völlig neuen Dynamik gesellschaftlicher Entwicklungen führen, weil die dort aufwachsenden Menschen kreativer und selbstbewußter sind, Dinge stärker hinterfragen, gesellschaftliche Prozesse bewußter erleben, und Zustände gegebenenfalls in ihrem Sinne demokratisch verändern werden. Werte lasse sich dann nicht mehr einfach an die nachwachsenden Generationen vererben, sondern sind dem freien Markt der Ideen ausgesetzt und müssen junge Leute überzeugen. Das derzeitige zentralistische Schulsystem mit seinen Lehrplänen und Hierarchien hingegen ist in seiner Wirkung außerordentlich konservativ (am Bestehenden festhaltend) und führt so zu einer Lähmung der Demokratie.
Ein freies Bildungssystem mit demokratischen Schulen wird eine veränderte Gesellschaft zur Folge haben. Der Zusammenhang von Schule und gesellschaftlicher Veränderung ist allerdings ein sehr heikler. Immer wieder haben diverse politische Bewegungen versucht, ihre gesellschaftsverändernden Ziele zu erreichen, indem sie die Schulen in ihrem Sinne veränderten bzw. dies beabsichtigten. Auch einige Befürworter der hier vorgeschlagenen Änderungen am Schulwesen verfolgen damit in Wirklichkeit in erster Linie bestimmte gesellschaftliche Ziele. Wenn es in einem freien Bildungswesen jedoch zuallererst um die Interessen der Schüler gehen soll, darf das Bildungssystem nicht als Revolutionshilfsmittel instrumentalisiert werden. Nicht weil mit der sonstigen Gesellschaft etwas nicht stimmt, muß das Schulsystem verändert werden, sondern weil Schule, so wie sie zur Zeit ist, schlecht ist. Die Demokratisierung von Schule wäre auch dann richtig, wenn die Menschen, die dabei am Ende rauskommen, nicht den Vorstellungen der Gesellschaftsveränderer entsprechen. Wenn man allerdings ohnehin eine konsequent freie und demokratische Gesellschaft anstrebt, muß in dieser Gesellschaft auch das Bildungswesen gemäß dieser Grundsätze verändert werden – nicht als Mittel zum Zweck, sondern als tatsächliches eigenes Ziel.
Bei alledem wird man dennoch nicht auf Hochleistung verzichten müssen. Diese wird von hochmotivierten und interessierten Menschen auf freiwilliger Basis erbracht; und dazu sind keine Selektion und kein Drill erforderlich.
Die Chancengleichheit ist wahrscheinlich besser gesichert als heutzutage; dies entspricht zumindest der Erfahrung der Shaker Mountain School, einer demokratischen Schule im US-Bundesstaat Vermont, deren Schüler mehrheitlich aus Familien mit geringem Einkommen stammen. Da die Schüler an freiheitlichen Schulen freien Zugang zu Büchern, Computern und vielen anderen Dingen haben, ist es nicht so schlimm, wenn diese Ressourcen bei den Schülern zuhause nicht vorrätig sind.
Das, was man „zukunftsfähig“ nennt, ist am ehesten von einem derartigen Bildungssystem zu erwarten. So haben die Abgänger freiheitlich-demokratischer Schulen meist zahlreiche Eigenschaften, die Schülern autoritärer Schulen oftmals fehlen: Sie sind gut gebildet, offen für Neues, bereit, Herausforderungen anzunehmen und in der Lage, selbständig zu denken und Probleme zu lösen – jedenfalls überwiegend.
Bei aller Zukunftsfähigkeit darf man aber nicht vergessen, daß Kinder nicht nur eine Zukunft haben, sondern vor allem eine Gegenwart; und diese gilt es neu zu gestalten.
Finanzierung
Zu einem seriösen Konzept gehört auch, daß man sagt, wie das alles finanziert werden soll. Es dürfte für viele überraschend sein, daß sich solch ein Bildungssystem mit den derzeit zur Verfügung stehenden Geldern durchaus finanzieren läßt. Derzeit werden pro Schüler je nach Bundesland zwischen 3 680 € (Sachsen) und 5 980 € (Hamburg) pro Jahr vom Staat ausgegeben, im Durchschnitt ca. 4 450 € (wobei Grundschüler 3 500 und Gymnasiasten 5 100 € kosten). Damit läßt sich so einiges anfangen.
Wie kommen viele Leute überhaupt auf die Idee, freie Schulen würden mehr kosten als traditionelle? Was genau soll denn teurer an ihnen sein?
Als die Sudbury Valley School in Framingham (Massachusetts, USA) 1968 öffnete, wollte sie nicht nur beweisen, daß eine demokratische Schule vom Konzept her funktioniert, sondern auch, daß sie finanziell mit staatlichen Schulen mithalten kann. Sie startete mit einem Schulgeld, das den Pro-Schüler-Kosten der benachbarten staatlichen Schulen entsprach. Mittlerweile beträgt das Schulgeld an Sudbury Valley deutlich weniger als die Hälfte des Betrages, der staatlichen Schulen pro Schüler zur Verfügung steht! Während die Mitarbeiter an Sudbury Valley Gehälter erhalten, die denen an staatlichen Schulen entsprechen, sind die Mitarbeiter an kleineren Sudbury-Schulen in der Regel deutlich unterbezahlt, da sie aus Idealismus handeln und das Schulgeld gering halten wollen. Außerdem sind zahlreiche Einrichtungsgegenstände gebraucht gekauft, und vieles von Eltern und Händlern gespendet. Die Sudbury Valley School bekam beispielsweise das komplette Chemie-Labor vom Massachusetts Institute of Technology (MIT), als die sich ein neues zulegten. Bei einer flächendeckenden Verbreitung von Sudbury-Schulen ist wohl mit einem Rückgang der Materialspenden zu rechnen, da sich diese auf deutlich mehr Schulen verteilen. Wenn der Staat für die Finanzierung dieser Schulen zuständig ist, darf er solche Spenden allerdings ohnehin nicht von vornherein einplanen. Da die meisten Anschaffungen jedoch etliche Jahre halten, wären die zusätzlichen Pro-Schüler-Kosten nicht so dramatisch.
Demokratische Schulen mit Kursangebot sind aufgrund des höheren Bedarfs an Lehrern etwas teurer als Sudbury-Schulen. Dennoch kann davon ausgegangen werden, daß sich auch diese Schulen mit den derzeit zur Verfügung stehenden Finanzmitteln betreiben lassen.
Da wesentlich weniger Verwaltung und Bürokratie notwendig ist, lassen sich zusätzlich Gelder aus diesem Bereich innerhalb des Bildungssektors umschichten und sinnvoller verwenden. So kann die Lernmittelfreiheit vollständig wiederhergestellt werden und Schulen können angemessen ausgestattet werden.
Grundsätzlich soll gelten, daß Bildung den Nachfragenden nichts kostet. Um die freie Wahl der Bildungsangebote nicht zu beeinträchtigen und Kinder ärmerer Eltern nicht zu benachteiligen, ist es notwendig, nicht-staatliche Schulen finanziell genauso bedarfsgerecht zu fördern wie staatliche Schulen. Bildungseinrichtungen müssen finanziell so ausgestattet sein, daß sie nicht auf sonstige Einnahmen (z.B. durch Werbung, Sponsoring oder Schulgeld) angewiesen sind.
Durch Schülerfirmen eventuell erzielbare Einnahmen dürfen kein Vorwand für Kürzungen des Bildungsetats sein. Solange es dem Land (unter verantwortbarem Aufwand und bei Berücksichtigung seiner sonstigen Pflichten) weiterhin möglich ist, in gleichbleibendem Maße Geld für Bildung zur Verfügung zu stellen, sind Kürzungen, die die vollständige Unentgeltlichkeit von Bildung gefährden könnten, zu vermeiden. Ob das in Zukunft auch dann noch möglich ist, wenn sich die Haushaltslage weiter verschlechtert, ist vor allem eine Frage der Prioritätensetzung. Wenn sich im Landeshaushalt Geld für teure, aber unnütze Großprojekte finden läßt, wäre auch genug für Bildung da.
Von den staatlichen Bildungsausgaben ließen sich auch die oben beschriebenen Reisen finanzieren, sofern sie einen gewissen Gesamtbetrag nicht übersteigen. Die erwähnten Medienangebote würden ebenfalls aus dem Bildungshaushalt bezahlt werden. Insgesamt läßt sich in einem pluralistischen Bildungssystem mit den gleichen ca. 4 500 € pro Jahr und Schüler weitaus mehr machen als im heutigen zentralistischen Schulsystem, wo vielfach Geld für Sachen ausgegeben wird, die viele gar nicht haben wollen. (Man denke nur mal an die Arbeitszeit, die Lehrer derzeit mit dem Vorbereiten, Durchführen und vor allem Kontrollieren von Test, Klassenarbeiten und Klausuren verbringen. Oder daran, daß unter den jetzigen Bedingungen Bücher auch für jene Schüler angeschafft werden müssen, die sich für ein Thema gar nicht interessieren.) Wie die Verfahrensweise für die Finanzierung der verschiedenen Bildungsangebote genau aussehen soll, kann an anderer Stelle diskutiert werden.
Grundgesetz-Kompatibilität
Vom Grundgesetz aus gesehen ist ein freiheitlich-demokratisches Bildungssystem nicht nur möglich, sondern sogar notwendig.
Bildung ist nach gegenwärtigem Recht eine Angelegenheit der Bundesländer. In einigen Bundesländern, darunter Berlin, sind die Schulpflicht und sonstige Grundlagen der Bildungspolitik nicht in der Landesverfassung geregelt, so daß sich alle notwendigen Änderungen durch einfache Gesetze regeln lassen. In einigen anderen Bundesländern ist die Schulpflicht in der Landesverfassung festgeschrieben, so daß Verfassungsänderungen notwendig sind. Zu untersuchen bleibt die Vereinbarkeit mit den einzelnen Artikeln der jeweiligen Landesverfassung und mit dem Grundgesetz (GG).
Einige bildungspolitische Rahmenbedingungen legt das Grundgesetz in Artikel 7 fest. Absatz 1 besagt, daß „das gesamte Schulwesen (...) unter der Aufsicht des Staates“ steht. Es wird nicht gesagt, wie diese staatliche Aufsicht aussehen soll. Sinnvoll wäre ein „Bildungskontrollrat“, ein demokratisch gewähltes Gremium, in dem auch Schüler und Lehrer vertreten sind.
Laut Absatz 3 ist Religionsunterricht „in den öffentlichen [=staatlichen] Schulen (...) ordentliches Lehrfach“ – “mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen“. Ein freiheitlich-demokratisches Bildungssystem ist in der Religionsfrage neutral. Deshalb sind dann alle staatlichen Schulen „bekenntnisfrei“.
Absatz 2 besagt zwar, daß die Eltern bestimmen, ob ihr Kind am Religionsunterricht teilnimmt; aber dieses Elternrecht steht im Widerspruch zum Grundrecht des Kindes auf Religionsfreiheit (s. Artikel 4 GG). Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von 1968 ist das Elternrecht (Artikel 6 (2) GG) ein „treuhänderisches Recht“, das nicht gegen das Interesse des Kindes ausgeübt werden darf und insbesondere nicht die Grundrechte des Kindes verletzen darf. Entsprechend wird Artikel 7 (2) GG nicht umgesetzt. Kinder zur Teilnahme an einem Religionsunterricht zu zwingen, wird nicht möglich sein.
Absatz 4 sichert das Recht zu, private [=nicht-staatliche] Schulen einzurichten. Die Anforderung, daß die privaten Schulen „in ihren Lehrzielen (...) nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen“, ist automatisch erfüllt, weil es in staatlichen Schulen gar keine Lehrziele mehr gibt (weil ein verbindlicher Lehrplan nicht mehr existiert). Über die geforderte Gleichwertigkeit der Ausbildung der Lehrer könnte der Bildungskontrollrat wachen. Die Bedingung, daß „eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird“, kann sogar nur durch die volle finanzielle Gleichstellung „privater“ Schulen erfüllt werden.
Absatz 5 fordert: „Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt“. Mit „Volksschule“ ist die Grundschule sowie die Hauptschule gemeint. Das für die Zulassung erforderliche „besondere pädagogische Interesse“ sollte verhindern, daß Besserverdienende ihre Kinder bereits im Grundschulalter nur aus dem Grund auf Privatschulen schicken, daß sie sich nicht mit der dort anzutreffenden Armut auseinandersetzen müssen. In einem pluralistischen Bildungswesen – das durch die bedarfsgerechte Finanzierung aller Schulformen auch einer Selektion vorbeugen kann – besteht automatisch ein Interesse an abweichenden Schulformen, und damit auch das besondere pädagogische Interesse. Freie Schulen im Grundschulbereich sind nicht mehr nur Versuche oder Ausnahmen, sondern wichtiger dauerhafter Bestandteil der Bildungslandschaft. In vielen Fällen werden Grund- und Oberschulen jedoch nicht mehr getrennt, sondern zu einer Schule für alle Altersgruppen vereinigt sein.
Artikel 7 GG ist also nicht optimal, schließt aber ein freiheitlich-demokratisches Bildungssystem auch nicht aus. Außerdem steht das jetzige Schulsystem im Konflikt mit zahlreichen Passagen des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ „Die Freiheit der Person ist unverletzlich.“ „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.“ „Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“ „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit [...] (wird) gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“ „Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.“ „Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.“ „Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.“ „Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.“ „Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.“ „Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.“ „In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.“
Die Verfassung des Landes Berlin wiederholt noch mal einige Grundrechte und fügt all dem noch hinzu: „Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Das Land ermöglicht und fördert nach Maßgabe der Gesetze den Zugang eines jeden Menschen zu den öffentlichen Bildungseinrichtungen (...)“.
Die Alltagspraxis muß endlich in Übereinstimmung mit diesen Verfassungsgrundsätzen gebracht werden, Gesetze und Verordnungen müssen daran angepaßt werden.
Der Übergang zur Freiheit
Die Unterschiede zwischen dem bestehenden Schulsystem und den angestrebten freiheitlich-demokratischen Verhältnissen sind unübersehbar groß.
Wenn man sich über die Untauglichkeit und Schädlichkeit des gegenwärtigen Systems im Klaren ist, mag man geneigt sein, es buchstäblich von heute auf morgen durch ein freies Bildungssystem zu ersetzen. Doch was passiert mit all den Schülern, die auf völlige Freiheit nicht gefaßt sind und hochgradig verunsichert wären, was mit all den angefangenen Schullaufbahnen? Was passiert mit all den Schulgebäuden und all den Lehrern? Eine unbedachte, blinde Zerstörung des Zwangsschulsystems ist daher eher unangebracht.
Es kommt darauf an, einen geordneten Übergang zu organisieren. Die einzelnen Schritte, die auf dem Weg zu einem freiheitlich-demokratischen Bildungssystem nötig sind, sollen Schülern und Lehrern Zeit zur etappenweisen Umgewöhnung geben. Der Übergang darf sich jedoch nicht in Reförmchen verlieren, sondern muß zielstrebig erfolgen. Die Umstellung mag schwierig sein, aber sie ist auch sehr nötig.
Nachfolgend wird versucht, einen möglichen Weg aufzuzeigen. Bevor die strukturellen Veränderungen beschrieben werden, die sich durch Gesetze und Verordnungen beschließen lassen, soll jedoch zunächst auf einige Aspekte eingegangen werden, die sich nicht auf diese Weise regeln lassen.
Allgemeine Probleme bei der Umstellung
Ein Problem bei der Umstellung zu einem freiheitlichen Schulsystem sind die Lehrer. Viele Lehrer identifizieren sich mit dem jetzigen System; aber Lehrer, die Unfreiheit verteidigen bzw. praktizieren, passen nicht in ein freies System. Da zumindest in den staatlichen Schulen die Schulversammlung entscheidet, welche Lehrer eingestellt werden, würden zahlreiche von ihnen dort keine Anstellung mehr finden. Andererseits hätten diese Lehrer wahrscheinlich auch selbst wenig Interesse daran, in einem demokratischen Bildungssystem tätig zu sein. Möglicherweise können sie mit Lehrern jener Schulen tauschen, die unfrei bleiben. Älteren Lehrern könnte man anbieten, in Vorruhestand zu gehen. Den umstellungsbereiten Lehrern wird eine besondere Schulung angeboten, die ihnen hilft, sich auf die neuen Anforderungen einzustellen. In demokratischen Schulen haben sie in Kursen mit Schülern zu tun, die tatsächlich an ihrem Unterricht interessiert sind. Sie müssen nicht mehr stundenlang Klassenarbeiten kontrollieren und nicht mehr vorgeben, unfehlbar zu sein. In jedem Fall wird es notwendig sein, Lehrer nicht mehr zu verbeamten, da sie sonst weiterhin unkündbar wären.
Gesetze, also die „Spielregeln“ des Schulsystems, lassen sich durch Beschluß ändern, nicht aber die Einstellungen der Lehrer, Schüler, Eltern sowie der sonstigen Gesellschaft. Ob die Änderungen bei ihnen auf Akzeptanz treffen oder Widerstand auslösen, kann man den betroffenen Menschen nicht vorschreiben. Man kann aber versuchen, ihre Zustimmung und ihr Verständnis zu gewinnen. Und ohne daß wenigstens ein relevanter Anteil der Bevölkerung diese Neuausrichtung des Bildungssystems befürwortet, wird es zu einem entsprechenden Beschluß ja ohnehin nicht kommen.
Die beabsichtigten Veränderungen sind zwar sehr grundlegend, aber für die Beteiligten nicht bedrohlich. Niemand muß um sein Leben oder auch nur um seine Freiheit fürchten. Traditionelle Schulen bleiben erhalten, aber es gibt eben auch viele andere. Im Grunde geht es vor allem darum, diese Vielfalt und die freie Entscheidung der Schüler zu tolerieren.
Die Bereitschaft, an den bisherigen Verhältnissen etwas zu ändern, entsteht am ehesten, wenn den Leuten die Schwächen des aktuellen Systems bewußt werden bzw. wenn sie erkennen, daß Alternativen tatsächlich möglich und erfolgreich sind. Entsprechend muß erst mal auf die Widersprüche des bestehenden Schulsystems aufmerksam gemacht und plausibel erklärt werden, warum der gewünschte Erfolg bisher ausbleibt. Des weiteren muß versucht werden, die weitverbreiteten Vorurteile abzubauen und darüber aufklären, wie Lernen tatsächlich funktioniert. Gleichzeitig kann man auf die Erfolge von zahlreichen Freien Alternativschulen und demokratischen Schulen wie der Sudbury Valley School hinweisen und somit die Befürchtungen vieler Leute auch praktisch widerlegen.
In einem pluralistischen Bildungssystem kann nicht (bzw. genauso wenig wie jetzt) ausgeschlossen werden, daß einzelne Lehrer Unsinn erzählen bzw. sogar bewußt Unwahrheiten verbreiten. Um dies gegebenenfalls aufzudecken, kann es eine unabhängige Instanz geben, die ähnlich wie z.B. Stiftung Warentest die Angebote (stichprobenartig oder auf konkreten Verdacht) qualitativ untersucht. Der beanstandete Lehrer bzw. die Bildungsanstalt wird dann auf die Unstimmigkeiten hingewiesen. Sollte der „Anbieter“ entgegen besseren Wissens die Schüler weiterhin falsch informieren, kann der Bildungskontrollrat, der die Schulaufsicht ausübt, beschließen, daß die Schule keine staatlichen Gelder mehr erhält und daß nötigenfalls ein Verfahren wegen Betruges eingeleitet wird. Allerdings ist dieser ganze Punkt etwas problematisch, vor allem wenn es um die Darstellung von geschichtlichen oder gesellschaftlichen Dingen geht, da dies im Zweifelsfall eine ”offiziell” für zutreffend befundene Sicht voraussetzt. Die im Grundgesetz garantierte Freiheit der Lehre bezieht sich zwar nur auf Hochschulen. In einem pluralistischen Bildungssystem sollte sie aber auch für reguläre Schulen gelten.
Ein weiteres Problem, das die Neuentstehung und Dezentralisierung von Schulen mit sich bringt, sind die Räumlichkeiten. Bei weitem nicht alle Schulen werden derart viele Kinder und Jugendliche umfassen, wie jetzige Schulen. Die staatlichen Schulen mit Kursangebot (und auch einige nicht-staatliche Schulen) könnten in ihren Schülerzahlen mit jetzigen Schulen durchaus konkurrieren, da es bei diesen Schulen reicht, wenn die einzelnen Kurse überschaubare Größen haben. Zumindest bei größeren bisherigen Schulgebäuden wird nur ein Teil des Gebäudes als Schule verwendet werden; die anderen Teile sowie die nach Schließungen von Schulen leerstehenden Gebäude können als Verwaltungs- oder Bürogebäude verwendet werden, obwohl es davon ja schon mehr als genug gibt. Ein weiterer Teil kann in Bibliotheken, Jugendclubs und Vereinsräume umgewandelt werden.
Die vielen neuen kleinen Schulen können in neu anzumietenden Büroräumen, in frei werdenden und umzubauenden Lager- und Fabrikhallen, in zusammenzulegenden Privatwohnungen oder großen Einfamilienhäusern am Stadtrand entstehen.
Da die Umstellung aber in mehreren Schritten erfolgen soll, bleibt genügend Zeit, um für diese – eher äußerlichen – Probleme rechtzeitig bzw. nach und nach Lösungen zu finden.
Abwicklung traditioneller Schulen
Nicht alle Schüler sind an einer Demokratisierung der Schule interessiert. Ein großer Teil der jetzigen Schüler findet die traditionellen Staatsschulen in Ordnung und wird sie daher so beibehalten wollen. Wie an früherer Stelle bereits angemerkt, können in einem pluralistischen Bildungssystem die verschiedensten Schulen existieren – auch Schulen, die nach dem jetzigen Prinzip funktionieren. Es darf nur niemand gezwungen werden, hinzugehen.
Das bedeutet, daß ein gewisser Anteil der derzeit bestehenden Schulen so bleiben wird, wie er ist. Nun muß bestimmt werden, wie viele und welche Schulen das konkret sind.
In traditionellen Schulen werden umfassend Grundrechte außerkraftgesetzt. Daher kann keinem Schüler zugemutet werden, (weiterhin) eine traditionelle Schule zu besuchen, ohne daß er sich aktiv dafür entschieden hat. Da die Schüler bisher nie gefragt wurden, ob sie tatsächlich auf eine unfreie Schule gehen wollen, wird dies nun nachgeholt. Nachdem den Staatschülern nachvollziehbar die Unterschiede zwischen den traditionellen und den demokratisierten Schulen dargelegt wurden und es ausreichend Gelegenheit gab, sich genauer zu informieren, erhält jeder Schüler die Möglichkeit, eine Vereinbarung zu unterschreiben, daß er mit der Funktionsweise der traditionellen Schulen einverstanden ist und auf Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verzichtet.
Aus der Anzahl der unterschriebenen Verzichtserklärungen ergibt sich, wie viele traditionelle Schulen in einem bestimmten Gebiet (z.B. in einem Stadtbezirk oder Landkreis) gebraucht werden. Die Schulen mit dem höchsten Anteil bleiben dann unfrei und undemokratisch. Alle Schüler, die sich für Unfreiheit entschieden haben, müssen dann auf eine nachwievor-traditionelle Schule gehen; alle anderen auf eine der zu demokratisierenden Schulen oder auf eine nichtstaatliche Schule ihrer Wahl.
Wer also bereits Schüler ist und sich nicht ausdrücklich für etwas anderes entscheidet, geht erst mal in die (neue) staatliche Standard-Schule, die nach und nach in eine Demokratische Schule mit Kursangebot überführt wird. Bei der Entscheidung über traditionelle oder zu demokratisierende Schulen ist der Schüler übrigens nicht auf die Zustimmung seiner Eltern angewiesen, da beide Möglichkeiten eine Kontinuität der Schullaufbahn darstellen: entweder wie bisher staatliche Schule (nun aber demokratisch) oder wie bisher traditionelle Schule (nun aber nicht mehr staatlich).
Wichtiger Bestandteil des bisherigen traditionellen Staatsschulsystems ist, daß sich alle Schulen vom Konzept her weitestgehend gleichen und zentralistisch verwaltet werden. Dies soll auch für die weiterhin traditionellen Schulen gelten. Da in einem neuen freiheitlich-demokratischen Bildungssystem das Bildungsministerium jedoch selbst nicht gerade viel vom Konzept traditioneller Schulen hält, muß die Verwaltung dieser Schule auf andere übertragen werden. Daher schließen sich die traditionellen Schulen, die so weitermachen wie bisher, in einem „Verband traditioneller Schulen“ zusammen.
Dieser Verband ist dann Träger dieser Schulen. Er entscheidet zentralistisch für all diese Schulen. Er legt fest, welche Autonomie die Einzelschule bekommt, welche Entscheidungsbefugnisse Schüler, Lehrer und Direktor jeweils haben. Er entscheidet über die Lehrpläne und darüber, wie der Unterricht stattzufinden hat. Der Verband traditioneller Schulen fängt inhaltlich genau mit dem an, was die staatliche Schulbürokratie ihm hinterlassen hat. Der Verband übernimmt komplett alle für die Staatsschulen geltenden Gesetze, Verordnungen und sonstigen Vorschriften. So werden den dort verbleibenden Schülern größere Umbrüche erspart und ihnen Geborgenheit in ihrer gewohnten Schulatmosphäre gewährt.
Jedoch hat es auch an traditionellen Schulen bisher immer mal wieder Veränderungen gegeben, die je nach Art der Änderung vom Landesparlament oder vom Bildungsminister bzw. Schulsenator beschlossen wurden. Nun jedoch verwaltet sich der Verband traditioneller Schulen selbst. Also muß innerhalb des Verbands ein zuständiges Gremium geschaffen werden. In diesem Rahmen können die Beteiligten dann über all jene Frage befinden, die in gegenwärtigen schulpolitischen Debatten eine Rolle spielen: Unterrichtsausfall, Alter neueinzustellender Lehrer, Klassengrößen, Zusammensetzung und Befugnisse der Schulkonferenz, Schulzeit bis zum Abitur, Formen der Bewertung, Ganztagsschulen, Unterrichtsinhalte. In seinen Entscheidungen ist dieses Gremium allerdings an die anfangs von den Schülern unterschriebene Erklärung gebunden. Grundrechte dürfen nicht stärker eingeschränkt werden als dort festgelegt.
Da die Schule ein Ort ist, an dem es hauptsächlich um die Schüler geht, wäre es angemessen, ihnen bei der Leitung dieses Verbandes, also bei der Wahl dieses Gremiums ein Mitbestimmungsrecht zu geben. Darüber, wie genau dieses Gremium zusammengesetzt sein soll, also wer bei dieser Wahl welches Mitspracherecht hat, wird man sich noch Gedanken machen müssen.
Sollten Schüler zu dem Schluß kommen, daß sie eine solche Schule nicht länger besuchen wollen, stehen ihnen die anderen Alternativen zur Verfügung.
Hier nun also der Vorschlag für eine fünfjährige Übergangsphase:
Das 1. Jahr der Reformen
Wenn – dem jeweiligen Bedarf entsprechend – traditionelle Schulen in ihrer jetzigen Form erhalten werden sollen, darf die Veränderung innerhalb der Staatsschulen erst beginnen, nachdem sich jene Schulen, die traditionell bleiben, ausgegliedert haben. Bevor sich die Schüler jeweils einzeln entscheiden, ob sie auf eine traditionelle oder auf eine zu demokratisierende Schule gehen wollen, bedarf es einer breiten Informations- und Aufklärungskampagne über die geplanten Veränderungen der Staatsschulen. Deshalb wird sowohl innerhalb der Staatsschulen als auch in den Medien ausführlich über die Änderungen informiert. An den Schulen gibt es Veranstaltungen für Lehrer, Schüler und Eltern, die sich verschiedenen Aspekten des Lernens in Freiheit widmen. Es ist vor allem wichtig, auch die Unterstützung der Eltern zu erlangen. Für diese Informationskampagne sollte bis zu ein Jahr veranschlagt werden. Am Ende des betreffenden Schuljahres kann dann entschieden werden, welche Schulen traditionell bleiben und welche demokratisiert werden.
Allerdings kann man während dieses ersten Jahres bereits Veränderung an der Struktur des Bildungswesens vornehmen:
Die Genehmigung nichtstaatlicher Schulen wird vereinfacht. Und diese werden ab dem 1. Betriebsjahr genauso wie staatliche Schulen finanziert. Damit wird der Grundstein für ein pluralistisches Bildungssystem gelegt.
Als Wegbereiter und Vorkämpfer (auch Modellversuch genannt) werden in drei oder vier unterschiedlichen Gegenden des jeweiligen Bundeslandes damit begonnen, eine Schule nach dem Sudbury-Modell zu gründen. Auch vollständig demokratisierte Schulen mit Kursangebot werden hier und da neu geschaffen, um so vor der flächendeckenden Einführung jeweils noch einige Erfahrungen sammeln zu können.
Das Schulregelungs-Berechtigungs-Modell wird eingeführt und das Amt für freie Wahl der Bildung eingerichtet. Schüler können damit faktisch zwischen den bestehenden Schulen wählen, da die letztendliche Entscheidung bei ihnen liegt.
Der Schulzwang, also die Durchsetzung der Schulpflicht mit Polizeigewalt gegen den Willen des Schülers (Zwangszuführung), wird aufgehoben; das heißt, Schulverweigerer und ihre Eltern werden nicht mehr polizeilich verfolgt. Laufende Bußgeldverfahren werden eingestellt, sofern der Schüler deutlich machen kann, daß es seine eigene Entscheidung war, die Schule nicht mehr zu besuchen. Für sehr dringend ausstiegswillige Schüler wird nach individuellen Lösungen gesucht.
Auf Kommunal- und Landesebene werden bestehende Schülervertretungen so umstrukturiert, daß sie demokratischen Prinzipien gerecht werden und Schüler jeden Alters und aller Schultypen repräsentiert werden.
Das 2. Jahr der Reformen
Nachdem die traditionell-bleibenden Schulen ausgegliedert sind, also ab dem 2. Jahr der Reformen, beginnt der Demokratisierungsprozeß in den staatlichen Schulen.
Die zu demokratisierenden Schulen sind nun ein gemeinsamer Ort für bisherige Grundschüler und Schüler der verschiedenen Oberschularten. Eine Trennung in Gymnasial-, Real- und Hauptschüler gibt es an staatlichen Schulen nicht mehr.
Zunächst wird die Vergabe von Zensuren eingestellt, da sie die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Lernen auf das Bestehen von Prüfungen ablenken und reines Auswendiglernen begünstigen, zur Bewertung völlig unbrauchbar sind und die Übermacht des Lehrers sichern und so Unterordnung erzwingen. Schüler müssen nicht länger Interessiertheit vortäuschen. Die Machtunterschiede zwischen Lehrern und Schülern nehmen ab. Den Schülern soll die Angst vor der Schule genommen werden. Zur leichteren Entwöhnung von der Zensurengebung gibt es anfangs allerdings noch Lernerfolgskontrollen und Klassenarbeiten, die auch gemeinsam ausgewertet werden, ohne Schüler jedoch für Fehler zu bestrafen. Außerdem muß kein Schüler mehr gegen seinen Willen ein komplettes Schuljahr wiederholen.
Grundsätzlich sollen Lehrer erklären, welche Relevanz der jeweilige Unterrichtsstoff für das Leben der Schüler haben kann, unter welchen Umständen er überhaupt eine Rolle spielt bzw. daß er für die Schüler zumindest erst mal eigentlich ohne weiteres verzichtbar ist. Innerhalb der Kurse können die Schüler in stärkerem Maße eigene Fragen einbringen und zusätzlichen, ihnen interessant erscheinenden Details nachgehen.
Die Schule bietet, ggf. in Zusammenarbeit mit anderen Schulen, Kurse zu bisher in der Schule kaum behandelten Themen an, wie z.B. Astronomie, Jura, Journalismus und Fotografie. Die Schüler können auch selbst Kurse, Projekte und Veranstaltungen anbieten. Für diese zusätzlichen Kurse und Projekte ist die Trennung nach Altersstufen aufgehoben und eine Abweichung vom 45-Minuten-Takt grundsätzlich möglich.
Um die Versammlungsfreiheit nicht einzuschränken, darf Schülern, die während der Unterrichtszeit an Demonstrationen oder anderen politischen Veranstaltungen teilnehmen, daraus kein Nachteil erwachsen. Die Schüler sind jedoch verpflichtet, ihre Abwesenheit jenen Lehrern mitzuteilen, bei denen sie in dieser Zeit Unterricht hätten.
Es wäre unlogisch, jenen Schülern, die bereits jetzt wissen, was sie wollen und was nicht, und die ihr Lernen selbst in die Hand nehmen wollen, diese Freiheit zu verwehren. Schließlich ist das Ziel dieser Reformen die völlige Lernfreiheit, und Lernzwang wird nur deshalb erst nach und nach aufgehoben, um den Schülern eine Umgewöhnung zu erleichtern. Daher ist die Befreiung von Pflichtfächern auf begründeten Antrag hin zu genehmigen. In dem Antrag soll der Schüler darlegen, warum er glaubt, auch ohne diesen Kurs auszukommen.
Für neueingeschulte Kinder besteht von vornherein keine Pflicht, irgendwelche Fächer zu besuchen – da sie keine traditionelle Schulerfahrung haben, gibt es auch nichts davon zu entwöhnen. Neue Schüler werden ohnehin nur auf eigenen Wunsch in die Schule aufgenommen. Alles wichtige über die Eigenverantwortung für ihr Lernen erfahren sie im Aufnahmegespräch. Auch für etwas ältere Schüler darf sich während der Verminderung des Pflichtcharakters von Schule keine zwischenzeitliche Erhöhung der Unfreiheit (beispielsweise im Rahmen des Erreichens neuer Klassenstufen) ergeben.
Nach Abschluß der Demokratisierung werden manche Schüler die Schule nur für einzelne Veranstaltungen nutzen, andere werden praktisch jederzeit eine Veranstaltung besuchen und die Schule damit zu ihrem vorrangigen Lernort machen. Jedenfalls müssen die Schüler die Möglichkeit haben, sich auch jenseits der Teilnahme an Kursen in der Schule aufzuhalten und sie wie eine Freizeiteinrichtung nutzen zu können. Deshalb müssen neben einer Bibliothek mit Leseräumen und Internetzugängen auch Aufenthaltsräume, ein Café, ein Spielplatz, etc. geschaffen werden. Gerade für die neueingeschulten Kinder, die von vornherein keine Pflichtkurse haben und daher einen Teil der Zeit ohne Unterricht verbringen werden, sind diese Gelegenheiten wichtig.
Neben der Freiheit des Lernens ist die demokratische Selbstverwaltung eines der zentralen Merkmale einer Schule, die freiheitlich und demokratisch sein will. Als erster Schritt in diese Richtung wird eine Schulversammlung ins Leben gerufen, in der jeder Schüler und jeder Lehrer oder sonstige Mitarbeiter eine Stimme hat, die jedoch zunächst nur beratende Funktion hat. Letztendlich entscheidet die bisher zuständige Instanz (Schulkonferenz, Lehrerkonferenz, Direktor). Diese Instanzen müssen ihre Vorhaben der Schulversammlung vorlegen; und die Schulversammlung ist gegenüber diesen Instanzen antragsberechtigt, kann ihnen also konkrete Vorschläge zur Abstimmung vorlegen. Auf diese Weise bekommen die Schüler schon einmal einen Einblick in die Abläufe an der Schule, und es entwickelt sich ein Dialog zwischen Schülern und Lehrern über die Gestaltung der Schule.
Um der Schule einen vernünftigen Handlungsspielraum bei der Selbstverwaltung zu geben, muß sie auch die ihr zustehenden Gelder selbst verwalten dürfen. Dies darf jedoch nicht dazu führen, daß die Schule letztendlich nur den Geldmangel verwaltet, den höhere Instanzen zu verantworten haben. Ein finanzieller Spielraum für die Schule muß tatsächlich existieren.
Auf dem Weg zur Rechtsstaatlichkeit wird eine Vorform des Justizkomitees eingeführt, in dem Beschuldigte ihre Sicht der Dinge darlegen können und in denen jeder solange als unschuldig gilt, wie seine Schuld nicht nachgewiesen ist. Zufällig ausgewählte Schüler verschiedener Altersgruppen nehmen mit zunächst nur beratender Stimme Teil. Die Feststellung der Schuld und die Entscheidung über eine Strafe oder Wiedergutmachung liegt bei einem für diese Sitzung des noch in Gründung befindlichen Justizkomitees zufällig ausgewählten Lehrer.
Lehrer müssen die Persönlichkeitsrechte des Schülers achten und dürfen ihn nicht vor anderen Schülern bloßstellen. Bei Zuwiderhandlungen müssen auch sie sich vor einer Vorform des Justizkomitees verantworten. Lehrer werden sich davon verabschieden müssen, Schüler mittels erzieherischer Maßnahmen in eine von ihnen nicht gewollte Rolle zu drängen. Als wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung zwischen Schülern und Lehrern und als Grundlage für ein vertrauensvolles Verhältnis werden den Lehrern alle wichtigen Repressionsinstrumente genommen.
Homeschooling wird auf Antrag genehmigt. In dem Antrag sollen die Eltern bzw. ihre Kinder ihre Vorstellung vom Lernen zu Hause darlegen. Die Schulpflicht wird in eine Bildungspflicht abgeschwächt.
Das 3. Jahr der Reformen
Das bisherige System der Schulfächer wird zu einem lockeren Verbund von Kursen bzw. Projekten umorganisiert, die sich an Themen orientieren und bei Bedarf Inhalte verbinden, die bisher auf mehrere Fächer verteilt waren. In Absprache mit den Schülern können Lehrer vielfältigere Unterrichtsformen verwenden. Dazu zählen auch Projekte. Wenn man sich z.B. mit dem Leben im Mittelalter beschäftigt, vereint dies Aspekte von Geschichte, Landwirtschaft, Literatur, Kunst und Musik. Je nach Thema können sich Kurse über wenige Wochen oder mehrere Halbjahre erstrecken. Der 45-Minuten-Takt wird allgemein aufgehoben. In Projekten kann dadurch z.B. durchgehend den ganzen Vormittag gearbeitet werden.
Der Inhalt der bisherigen Fächer wird weiter in unvermindertem Umfang angeboten, ist jedoch auf mehrere Kurse verteilt. Innerhalb der Kurse gibt es keine Leistungskontrollen mehr.
Damit Schüler überhaupt die Zeit haben, Kurse besuchen zu können, die bisher nicht im Lehrplan vorkamen, und damit sie sich an die Freiheit auch bei der Themenauswahl gewöhnen können, wird die Menge der Pflichtkurse auf die Hälfte reduziert. Der Schüler muß zwar genauso viele Wochenstunden belegen wie im vorangegangenen Schuljahr, davon jedoch nur die Hälfte im Rahmen der Pflichtkursen seiner Klassenstufe, die andere Hälfte kann er sich unter allen verfügbaren Kursen auswählen. Wenn ein Schüler an den bestehenden Kursen nicht interessiert ist, kann er auch selbst Kurse und Projekte beantragen oder selbst durchführen. Schüler müssen sich also Gedanken darüber machen, was sie lernen wollen.
Aus der teilweisen Entbindung von Pflichtkursen ergibt sich eine Altersmischung. Einige Schüler werden die Chance nutzen, sich Bereichen zuzuwenden, an denen sie früher noch kein Interesse hatten. Einige Schüler werden nicht noch Jahre warten wollen, bis sie im vermeintlich richtigen Alter für ein Thema sind. Schließlich interessieren sich nicht nur Schüler genau eines Jahrgangs für konkrete Themen. Klassenstufen existieren zwar noch, aber die Schüler haben mehr Kontakt als bisher mit Schülern anderer Klassen.
Die im Vorjahr eingeführte Möglichkeit, sich von Pflichtkursen befreien zu lassen, gilt auch für die Wahlpflichtkurse.
Während man Universitäten im eigenen Bundesland dazu verpflichten kann, die Zulassung von Studienbewerbern nicht mehr vom Abitur, sondern vom Bestehen einer für das Studienfach spezifischen Eingangsprüfung abhängig zu machen, werden andere Bundesländer auf der „Allgemeinen Hochschulreife“ bestehen. Und auch ein erheblicher Anteil der Arbeitgeber legt noch wert auf Schulabschlüsse. Daher wird man sie zunächst beibehalten müssen. Die Neuorganisation der Kurse und die Möglichkeit, sich seinen Stundenplan selbst zusammenzustellen, ziehen jedoch eine Flexibilisierung der Anforderungen für die Abschlüsse nach sich. Jeder kann selbst entscheiden, über welchen Zeitraum er die zu belegenden Kurse verteilt und wann er die einzelnen Prüfungen ablegt. Schulabschlüsse werden auch nicht mehr davon abhängig gemacht, wie viele Jahre man eine Schule besucht hat, sondern ob man über das entsprechende Wissen und Können verfügt. Somit kann sich jeder unabhängig von seiner bisherigen Schullaufbahn prüfen lassen. Außerhalb von Schule Gelerntes zählt dabei in gleicher Weise.
Die bislang nur beratende Schulversammlung kann nun Regeln für das Zusammenleben in der Schule beschließen. Da die Eltern davon nicht direkt betroffen sind, dürfen sie in schulinternen Angelegenheiten auch nicht mehr mitbestimmen.
Lehrer bzw. allgemein Mitarbeiter werden den Schulen nicht mehr von der Bürokratie zugeteilt, sondern von der Schulversammlung eingestellt bzw. entlassen. Die Mitarbeiter der Schule müssen nicht ausgebildete Lehrer sein. Entscheidend ist allein das Votum der Schulgemeinschaft.
Für die Durchsetzung sämtlicher Regeln ist allein das Justizkomitee verantwortlich, in dem nun auch die Schüler stimmberechtigt sind. Lehrer können dabei auf gleicher Grundlage wie die Schüler zur Verantwortung gezogen werden.
Die Gleichberechtigung zwischen Schülern und Lehrern wird festgeschrieben.
Das 4. Jahr der Reformen
Die wöchentliche Mindestkursstundenzahl wird halbiert. Die Schüler haben die freie Auswahl zwischen den an der Schule angebotenen Kursen/Projekten/Veranstaltungen. Pflichtfächer, die gemäß eines verbindlichen Lehrplans zu besuchen wären, gibt es nicht mehr.
Da die bisherigen von Jahrgangsstufen abhängenden Fächervorgaben wegfallen, gibt es nun weder traditionelle Schulklassen noch Klassenstufen überhaupt. Statt dessen können alle Veranstaltungen von interessierten Schülern jeden Alters besucht werden. Damit trägt die Schule der Tatsache Rechnung, daß es nie zu spät ist, Dinge zu lernen, von denen man früher nichts wissen wollte.
Die Demokratisierung der Entscheidungsprozesse an der Schule wird vollendet, indem der Haushalt und alle Finanzen der Schule von der Schulversammlung nicht nur beraten, sondern auch entschieden werden. Die Schulversammlung ist nun alleiniges Entscheidungsgremium innerhalb der Schule. Der Schulleiter ist nicht mehr für die Leitung der Schule zuständig, sondern nur für deren Vertretung nach außen.
Um niemanden von vornherein von Arbeiten, die innerhalb der Schule anfallen, auszuschließen, kann die Schulversammlung Zuständigenposten und – für größere Arbeitsbereiche – Komitees einrichten, für die sich jeder Schüler und jeder Mitarbeiter zur Wahl stellen kann. Diese Zuständigen bzw. Komitees kümmern sich dann z.B. um die Ästhetische Gestaltung der Schule, um Hausmeisterarbeiten, Instandhaltung eventueller Grünanlagen, Bürokram oder die Buchhaltung der Schule und sind der Schulversammlung gegenüber rechenschaftspflichtig. Bei Bedarf können auch eigens für die genannten Aufgaben Mitarbeiter beschäftigt werden.
Das 5. Jahr der Reformen
In den auf Kursen basierenden Staatsschulen gilt die freie Kurswahl. Die Schüler sind nicht mehr verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Stunden pro Woche in der Schule zu verbringen.
Sudbury-Schulen werden flächendeckend eingeführt.
Nachdem zunächst die Schulpflicht in eine Bildungspflicht umgewandelt worden war, wird nun auch diese aufgehoben. Innerhalb von nur 5 Jahren ist das freiheitlich-demokratische Bildungssystem Wirklichkeit geworden.
Die wichtigsten Änderungen gegenüber der 1. Ausgabe
In „Bestandsaufnahme“ Kritik an Zensuren und Bewertungen klarer formuliert
„Über das Lernen“ komplett neugeschrieben
In „Existenzberechtigung staatlicher Schulen“ Notwendigkeit staatlicher demokratischer Schulen hervorgehoben
zahlreiche Korrekturen und Ergänzungen in „Schultyp 1: Sudbury-Schulen “
erläuternder Absatz zur Legitimität von Kursen in „Schultyp 2: Demokratische Schulen mit Kursangebot“
„Homeschooling“ ausführlicher und differenzierter
„Recht auf selbstbestimmte Bildung durchsetzen“ fast komplett neu geschrieben und wesentlich detaillierter
In „Wechselwirkungen mit der Gesellschaft“ Absatz über zu erwartende neue Dynamik gesellschaftlicher Veränderungen eingefügt
In „Finanzierung“ Überlegungen zu voraussichtlichen Kosten detaillierter
„Der Übergang zur Freiheit“ fast komplett neu geschrieben und wesentlich detaillierter
weiterführende Texte
K.R.Ä.T.Z.Ä. und Sudbury-Schule Berlin-Brandenburg e.V. (Hrsg.): Sudbury-Schulen – konsequent freie und demokratische Schulen (Eine Einführung), 2001
K.R.Ä.T.Z.Ä. und Sudbury-Schule Berlin-Brandenburg e.V. (Hrsg.): weitere Texte zu den Sudbury-Schulen , 2001
Martin Wilke: Schulpflicht überwinden!, , 1998/2002
„Schule“ in K.R.Ä.T.Z.Ä.: Die Diskriminierung des Kindes – ein Menschenrechts-Report, 1998
K.R.Ä.T.Z.Ä.: Fällt Euch denn nichts Besseres ein? – Kritik an populärer und oberflächlicher Schulkritik und Pseudo-Alternativen2001
K.R.Ä.T.Z.Ä.: Schulnoten abschaffen, 2001
Welche Fragen sind noch offengeblieben? Was klingt unlogisch?
Einwände, Anregungen usw. an:
K.R.Ä.T.Z.Ä.
Dunckerstr. 11
10437 Berlin
kraetzae@kraetzae.de
In diesem Heft, das nun in der zweiten, gründlich überarbeiteten Auflage vorliegt, werden Überlegungen angestellt, wie ein Bildungssystem aussehen kann, das den Anspruch einer sich freiheitlich und demokratische nennenden Gesellschaft auch auf Kinder und Jugendliche überträgt.
”Lernen in Freiheit – Ideen für ein freiheitlich-demokratisches Bildungssystem” geht unter anderem auf folgende Fragestellungen ein: Was ist am gegenwärtigen Schulsystem eigentlich so kritikwürdig? Wie findet Lernen überhaupt statt? Welche Rolle spielen dabei Modellbauen und Problemlösen, Spielen und Konversation? Welche Bedeutung sollen staatliche und nicht-staatliche Bildungseinrichtungen haben? Wie kann man sich demokratische Schulen, in denen es von vornherein keinen Lernzwang gibt, vorstellen? Welche anderen Bildungsmöglichkeiten sind denkbar? Wie kann das Recht des Kindes auf selbstbestimmte Bildung durchgesetzt werden? Kann das alles überhaupt finanziert werden? Welche Wechselwirkungen sind zwischen einem freiheitlich-demokratischen Bildungssystem und der sonstigen Gesellschaft zu erwarten? Und schließlich: Wie kann der Übergang vom derzeitigen zum hier vorgeschlagenen Bildungssystem aussehen?